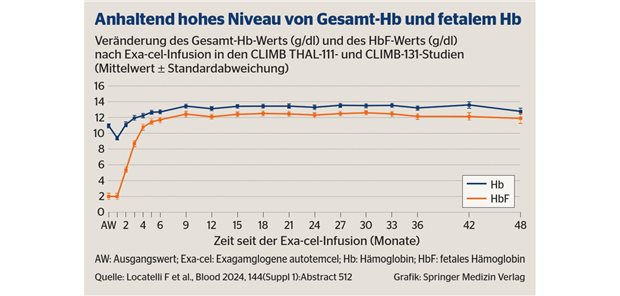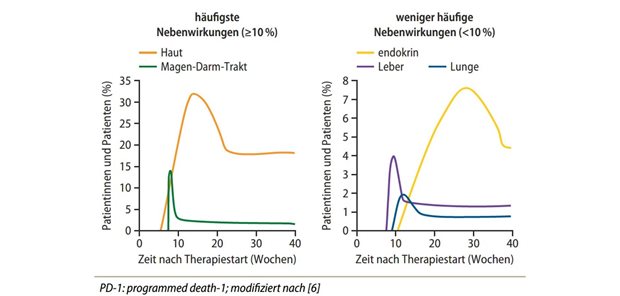Fachsymposium Onkologie
Versorgungsnahe Daten: Mehr Dialog mit Patienten!
Eine stark personalisierte Krebsversorgung braucht flexible Forschungsstrukturen, um Nutzen und Schaden von Therapien zügig abzuschätzen. Versorgungsnahe Forschung hat es aber weiterhin schwer. Weil der Patient nicht ernst genommen wird?
Veröffentlicht:
Für eine wissensgenerierende Forschung sind breitere Datensätze erforderlich, als sie die Klinischen Krebsregister liefern können.
© metamorworks / Getty Images / iStock
Berlin. Die Frequenz, mit der innovative Therapien in der Onkologie eingeführt werden, ist hoch. Für Gesundheitssysteme mit ihren Zulassungsprozederes und Nutzenbewertungsbürokratien erwächst daraus ein Dilemma: Einerseits sollen neue Therapien möglichst zügig den Patienten zugutekommen. Andererseits gilt es, möglichst „harte“ Evidenz zu schaffen, und zwar Evidenz einer Art, die auch das widerspiegelt, was die Krebspatienten sich tatsächlich von einer Therapie erwarten.
Um die Bewertung innovativer Medikamente in Zeiten starker Ausdifferenzierung onkologischer Erkrankungen zu flexibilisieren, setzen Krebsexperten und mittlerweile auch Teile der Politik auf eine versorgungsnahe Datenauswertung, die den klassischen Weg zur klinischen Evidenz, die randomisierte, kontrollierte Studie, nicht ersetzt, sondern flankiert.
Keine„Nutzenbewertung light“
Beim sechsten gemeinsamen Onkologie-Symposium von Springer Medizin, Pfizer und MSD, das in diesem Jahr erstmals rein virtuell stattfand, gab es eine Bestandsaufnahme des deutschen Wegs in Richtung institutionalisierte Versorgungsforschung.
Dr. Stefan Lange vom IQWiG betonte in Anlehnung an ein von seinem Institut im Frühjahr vorgelegtes Konzept zur Generierung und Auswertung versorgungsnaher Daten, dass derartige Forschung nur dann für eine Nutzenbewertung brauchbare Ergebnisse liefern werde, wenn nicht einfach irgendwelche Analysen vorgenommen würden.
Vielmehr müssten hohe Anforderungen an Studien- und Datenqualität erfüllt werden, was mit einem erheblichen logistischen und finanziellen Aufwand verbunden sei. Das Ziel könne und dürfe im Interesse der Patientinnen und Patienten nicht eine „Nutzenbewertung light“ sein.
Problem disparate Datenhaltung
Das sah auch Professor Monika Klinkhammer-Schalke vom Deutschen Netzwerk Versorgungsforschung so. Das DNVF hat im September, aufbauend unter anderem auf dem IQWiG-Konzept, unter dem Titel „Manual für Methoden und Nutzung versorgungsnaher Daten zur Wissensgenerierung“ einen Methodenleitfaden für eine wissensgenerierende Versorgung angekündigt.
Eine große Hürde auf dem Weg zur wissensgenerierenden Versorgung ist für Klinkhammer-Schalke weiterhin die sehr disparate Datenhaltung im deutschen Gesundheitswesen, die die nötigen längerfristigen Analysen von (pseudonymisierten) Krankheitsverläufen stark erschwere.
Zwar gebe es die Klinischen Krebsregister, die sich unter anderem um einen einheitlichen onkologischen Basisdatensatz hochverdient gemacht hätten. Für eine echte wissensgenerierende Forschung sind aber breitere Datensätze erforderlich, die auch Daten enthalten, die die Klinischen Krebsregister nicht liefern können.
„Was wir und andere vorschlagen, ist eine Art Institut für Versorgungsforschung, um Registerdaten zusammenzuführen und mit anderen Datenquellen zu verbinden“, so Klinkhammer-Schalke.
Viele Bedenken und Eigeninteressen
Mit der Datenzusammenführung ist das in Deutschland aber immer noch so eine Sache. Sie wird durch Datenschutzregularien, aber auch oder mehr noch durch institutionelle Bedenken und Eigeninteressen, stark erschwert. „Jeder sitzt auf seinen Daten wie die Henne auf dem Ei“, sagte Jan Geissler, Vorsitzender des LeukaNET und CEO des europaweiten Netzwerks Patvocates.
Diese Datenklüngelei sei eindeutig nicht das, was die Patienten wollten, wenn sie einer medizinischen Einrichtung die Zustimmung zur forschenden Verwendung der Daten erteilen. Generell sei bei gesunden Menschen die Annahme weit verbreitet, dass Patienten ihre Daten eher nicht teilen wollten, so Geissler. Das sei aber nicht der Fall, sofern Missbrauch hinreichend zuverlässig ausgeschlossen werde.
Die europäische Patientenorganisation EURORDIS, die sich um seltene Erkrankungen kümmert, hat das vor zwei Jahren mit Zahlen hinterlegt. Demnach sind 97 Prozent der Patienten mit seltenen Erkrankungen bereit, ihre Daten für die Entwicklung neuer Therapien oder für ein besseres Verständnis Krankheitsmechanismen zur Verfügung zu stellen. In der Allgemeinbevölkerung liege diese Quote dagegen nur bei 37 Prozent: „Die Diskussion um den Datenschutz findet zu oft ohne einen Dialog mit Patienten statt“, so Geissler.