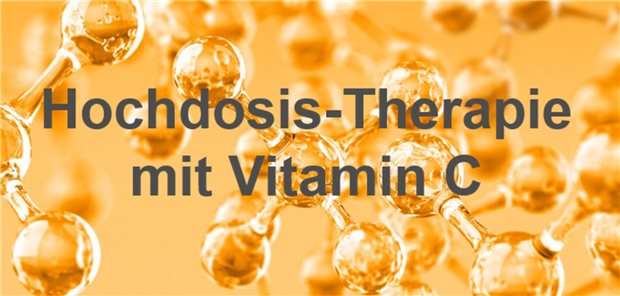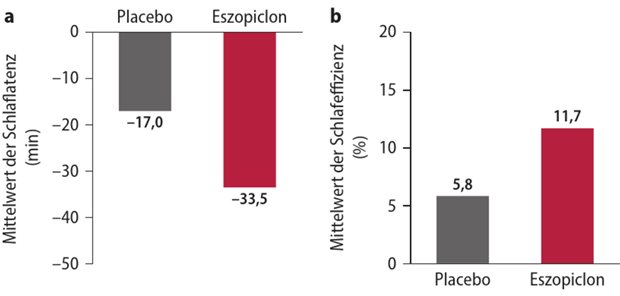Versorgungsprojekt „Mambo“
Wie MoniKa Ärzte und Patienten entlastet
Wie kommen multimorbide Patienten tatsächlich im häuslichen Umfeld mit ihrer Therapie, aber auch den Erkrankungen klar? In Leverkusen werden sie von speziell geschulten Monitoringassistentinnen unterstützt – das hat sich gerade in Corona-Zeiten bewährt.
Veröffentlicht:
Hausbesuche zählen zu den wichtigsten Tätigkeiten der Monitoring- und Kommunikationsassistentinnen (MoniKa).
© Halfpoint / stock.adobe.com
Leverkusen. Vor der Coronavirus-Pandemie konnte Helga Schleimer die Patienten und ihre häusliche Umgebung genau in Augenschein nehmen, jetzt braucht sie Geduld am Telefon und muss besonders gut hinhören. „Die Telefonate dauern manchmal eine bis anderthalb Stunden, ich lese viel zwischen den Zeilen“, berichtet Schleimer.
Die Pflegefachkraft ist als Monitoring- und Kommunikationsassistentin (MoniKa) im Versorgungsprojekt „Mambo“ des Gesundheitsnetzes Leverkusen und der Betriebskrankenkasse pronova beschäftigt. „Mambo“ steht für „Menschen ambulant betreut, optimal versorgt“.
Kern des Projekts, das durch den Innovationsfonds gefördert wird, ist die ambulante Versorgung von betreuungsintensiven multimorbiden Patienten (siehe Infobox).
Das Versorgungsprojekt „Mambo“
„Mambo – Menschen ambulant betreut, optimal versorgt“ ist ein gemeinsames Projekt des Regionalen Gesundheitsnetzes Leverkusen und der Betriebskrankenkasse pronova. Es wird wissenschaftlich begleitet vom Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft der Universität Köln (IMVR).
Im Mittelpunkt steht die verbesserte Versorgung von multimorbiden Patienten. Eingeschrieben werden können Versicherte der pronova BKK, die mindestens drei chronische Erkrankungen haben und/oder mindestens sieben Medikamente nehmen.
Kern von „Mambo“ ist die Unterstützung der ärztlichen Versorgung durch Monitoring- und Kommunikationsassistentinnen (MoniKa). Sie besuchen die Patienten zu Hause, ermitteln den medizinischen und sonstigen Unterstützungsbedarf und koordinieren die Versorgung der Patienten. Die MoniKas gelten als „verlängerter Arm des Hausarztes“.
Neben der höheren Versorgungsqualität zählt die bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure zu den Zielen des Projekts. Der Einsatz der MoniKas soll zudem die Ärzte entlasten und ihnen mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben verschaffen.
Beim Gesundheitsnetz sind vier MoniKas angestellt, zwei von ihnen sind ausschließlich für „Mambo“ im Einsatz. Die MoniKas sind Pflegefachkräfte oder MFA mit Zusatzausbildung. Eine wichtige Voraussetzung: „Man muss gut netzwerken können“, sagt Projektleiterin Anke Kurz von der pronova BKK.
Zu den Aufgaben der MoniKas gehören die Beratung und die Schulung der Patienten, etwa zu Präventionsmaßnahmen und zum Umgang mit Krisensituationen. Sie bieten ein gezieltes Monitoring bei Herzinsuffizienz und COPD.
Das Mitte 2017 angelaufene Projekt wird vom Innovationsfonds mit 3,4 Millionen Euro gefördert. Die zunächst auf drei Jahre angelegte Förderperiode ist bis Ende März 2021 „kostenneutral“ verlängert worden. Zurzeit sind 2670 Patienten eingeschrieben, 43 Ärzte nehmen teil.
Das Fördergeld fließt vor allem in die Anstellung der MoniKas sowie in die Einschreibepauschalen: Für die Einschreibung der Patienten erhalten die teilnehmenden Ärzte 70 Euro. Auch für externe Beratung werden Mittel verwendet.
Bei „Mambo“ arbeiten alle an der Versorgung Beteiligten mit einer gesicherten digitalen Plattform, die den Austausch ermöglicht. So haben die betreuenden Ärzte immer Zugriff auf die Informationen.
„Das Projekt wird kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt“, sagt Kunz. Dazu trägt auch die Rückkopplung aus der projektbegleitenden Evaluation durch das IMVR bei. Die Beteiligten hoffen, dass die Ergebnisse der wissenschaftlichen Auswertung so gut sind, dass „Mambo“ Eingang in die Regelversorgung finden wird. (iss)
Unterstützungsbedarf ist groß
Schleimer und ihre Kollegin Anita Heinzelmann sind die Bindeglieder zwischen den Patienten und den betreuenden niedergelassenen Ärzten. Ein wichtiger Teil ihrer Tätigkeit ist es eigentlich, die Erkrankten in ihrem Umfeld zu besuchen, um sich einen Überblick über den individuellen Unterstützungsbedarf zu verschaffen und auf dieser Basis die Versorgung zu koordinieren.
Mit dem Beginn der Corona-Krise sind die Hausbesuche entfallen. „Wir fangen jetzt langsam wieder damit an“, berichtet Schleimer. Besucht werden zunächst die Patienten, bei denen der persönliche Kontakt dringend notwendig erscheint. „Viele wollen noch keinen Besuch.“
Die Erfahrungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Betreuung via Telefon besser funktioniert als gedacht. „Die Kontakte waren sehr intensiv“, sagt Schleimer.

MoniKa Helga Schleimer musste während der Corona-Hochphase auf Telefonkontakte umschwenken.
© Mauro Bellissimo
Am Anfang waren viele Patienten sehr unsicher, wie sie sich verhalten sollten, ob sie etwa zum Arzt gehen sollten oder nicht. Hier musste sie viel Aufklärungsarbeit leisten.
Häufig ging es darum, Unterstützung zu organisieren, zum Beispiel für Demenzkranke. Viele pflegende Angehörige waren überfordert, weil Angebote wie die Tagespflege oder Demenzcafés auf einen Schlag weggebrochen sind.
Die MoniKas haben den Angehörigen aufgezeigt, welche Alternativen es gibt und Kontakte vermittelt. „Danach haben wir uns erkundigt, ob es klappt.“ Patienten mit Demenz haben häufig Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen.
Telefonate gegen die Depression
Auch in praktischen Alltagsdingen sprang die MoniKa zu Beginn der Krise ein. Sie kümmerte sich darum, dass die Patienten ihre Arzneimittel erhielten, und organisierte Hilfe beim Einkaufen. „In Leverkusen hat sich ein neues Netzwerk gebildet, auf das wir zurückgreifen können“, berichtet Schleimer.
Einige der Menschen, die sie betreut, hatten während des Lockdowns mit Depressionen zu kämpfen. „Gerade bei Patienten, die allein leben, waren die Telefonate eine wichtige Stärkung.“
Alle medizinisch relevanten Informationen, die Schleimer bei ihren Gesprächen mit den Patienten erhält, gibt sie an die behandelnden Ärzte weiter. Sie setzen sich dann bei Bedarf direkt mit den Betroffenen in Verbindung.
Für Schleimer steht fest: „Das Konzept der MoniKa hat sich in der Krise bewährt.“ Die MoniKas haben sogar noch neue Versorgungsfelder entdeckt wie die Unterstützung im Haushalt oder die enge Begleitung von Menschen mit depressiven Verstimmungen.
Grundsätzlich wird der Besuch vor Ort aber Kern der Arbeit bleiben. Manches erkennt man eben nur, wenn man bei den Patienten zu Hause ist.
Enge Abstimmung mit dem Arzt
„In manchen Wohnungen habe ich gelbe Säcke voller Arzneimittelschachteln gesehen“, berichtet Rita Knieper, die bis vor Kurzem ebenfalls bei „Mambo“ als MoniKa gearbeitet hat. Bei vielen Patienten stimmt der vom Hausarzt ausgefüllte Medikationsplan nicht mit dem überein, was sie tatsächlich an Mitteln zu Hause haben. „Wir nehmen das dann auf und faxen es an den Arzt“, erläutert die Krankenschwester.
Wenn die MoniKa sieht, dass bei der Einnahme der Medikamente etwas nicht richtig läuft, versucht sie zu klären, woran es liegt und dann gemeinsam mit dem Patienten die Probleme aus dem Weg zu räumen.

MoniKa Rita Knieper schätzt an den Besuchen, dass sie dort mehr Zeit fürs Patientengespräch hat.
© Gesundheitsnetz Leverkusen
„Man hat die Zeit, die in den Praxen für so etwas fehlt“, sagt Knieper. Nachdem sich die Patienten bei ihrem Arzt in das Projekt eingeschrieben haben, macht das Netzbüro einen Termin aus. Manche sind anfangs skeptisch, wenn sich plötzlich fremde Personen um sie kümmern wollen.
„Sobald sie aber hören, dass der Arzt einbezogen ist, haben sie Vertrauen.“ Wie häufig die MoniKas in Kontakt mit den Patienten sind, hängt von der Schwere der Erkrankung und der Betreuungssituation zu Hause ab.
Manchmal kann der Einsatz sehr intensiv werden. So musste Knieper für eine ältere Patientin innerhalb von einem Tag eine Palliativversorgung organisieren, was ihr auch gelang. Der Kerngedanke „Wir wollen die Versorgungssituation erheblich verbessern“ gilt für alle Situationen.
Patienten und Angehörige sind dankbar
Das Feedback zeigt den MoniKas häufig, dass sie dem Anspruch tatsächlich gerecht werden können. Viele Patienten bedanken sich für die Unterstützung, Angehörige für die Entlastung. Ein untrügliches Indiz für die Akzeptanz von „Mambo“ ist, dass die Patienten durch die Bank bei der Stange bleiben.
Auch unter den Pandemie-Bedingungen hat sich kein einziger ausgeschrieben. „Bei uns im Büro sind während der Krise Anfragen eingegangen von Menschen, die sich nach einer Teilnahme erkundigt haben“, berichtet Nicole Balke, Leiterin Versorgungsmanagement in dem Projekt.
Auch alle Ärzte sind trotz der Pandemie bei der Stange geblieben. „Wir haben sogar noch eine Praxis hinzugewinnen können“, freut sich Balke.
Zwei Ärzte erläutern, warum sie bei „Mambo“ mitmachen
Die Zahl der Haus- und Fachärzte, die sich am Versorgungsprojekt „Mambo“ beteiligen, ist kontinuierlich gewachsen. Die hausärztliche Internistin Dr. Stefanie Meyer zu Altenschildesche und der Lungenfacharzt Norbert Mülleneisen aus Leverkusen erklären, warum sie dabei sind:
Ärzte Zeitung: Wo sehen Sie die Vorteile eines Versorgungsprogramms wie „Mambo“?
Dr. Stefanie Meyer zu Altenschildesche: Aus hausärztlicher Sicht ist es eine wichtige Unterstützung. Ich möchte meine Patienten gut versorgt wissen. Ich weiß, dass ich das allein mit der Praxissprechstunde oft nicht erreichen kann. Die MoniKa erkennt bei den Hausbesuchen viele Probleme, die mir verborgen bleiben. Sie ist ein wichtiges Bindeglied.

Dr. Stefanie Meyer zu Altenschildesche ist Fachärztin für Innere Medizin und seit 2009 in der Gemeinschaftspraxis DHM in Leverkusen als hausärztliche Internistin tätig. Medizin studierte sie an der Universität Köln.
© René Sutthoff
Norbert Mülleneisen: Die MoniKa hat auch den Blick für die alltäglichen Dinge. Sie sieht die Stolperfallen in der Wohnung und bemerkt, wenn der Kühlschrank leer ist. Die MoniKa ist eine Art Übersetzungshilfe.
Wir Ärzte bemühen uns, evidenzbasiert zu arbeiten. Die Studien spiegeln die Situation im Alltag aber nicht wider. Von der MoniKa bekommen wir das, was ich als „real world evidence“ bezeichnen würde.
Wie bewerten Sie die Rolle der MoniKa beim Arzneimittel-Management?
Meyer zu Altenschildesche: Bei Medikamenten-Umstellungen haben wir häufig das Problem, dass sie viele Patienten verunsichern. Die Tabletten sehen anders aus und heißen auch anders. Das stiftet Verwirrung.
Ich selbst bemerke das häufig gar nicht, die Therapie beeinflusst es jedoch negativ. Die MoniKa hat die Zeit, die Zusammenhänge zu erklären.
Mülleneisen: Für mich ist es extrem wichtig, dass ich eine Rückkoppelung aus dem Alltag der Patienten bekomme. Ein Beispiel: Ich schlage den Austausch eines Arzneimittels vor, der Hausarzt setzt das um, aber der Patient nimmt das neue Mittel nicht. In der Regel bekomme ich so etwas nicht mit, die MoniKa aber schon. Bei ihrer Arbeit ist das Arzneimittelmanagement ein wesentlicher Faktor.
Weiß die MoniKa, worauf sie achten muss?
Mülleneisen: Ich trainiere sie im Umgang mit verschiedenen Spraydosen, die bei mir eine wichtige Rolle spielen. Ich sage den Patienten zwar in der Praxis, dass sie die Dose vor dem Inhalieren schütteln müssen. Viele merken sich das aber nicht. Die MoniKa guckt da gezielt hin.

Norbert Mülleneisen ist Facharzt für Innere Medizin und Lungen- und Bronchialheilkunde und seit 1996 in Leverkusen niedergelassen. Medizin studierte er in Köln, Berlin und Boston (USA).
© Ilse Schlingensiepen
Erleichtert die Arbeit der Assistentinnen Ihren Praxisalltag?
Mülleneisen: Auf jeden Fall. Die Patienten kommen besser vorbereitet und mit konkreten Fragestellungen in die Praxis, insbesondere was die Arzneimittel betrifft. Oft geht es um ganz banale Fragen, aber die Patienten trauen sich nicht, sie dem Arzt zu stellen.
Bei der MoniKa ist das anders. Bei Erkrankungen wie Herzinsuffizienz und COPD kann sie den Patienten die Unsicherheit und die Angst nehmen.
Meyer zu Altenschildesche: Das Gefühl von Sicherheit und eine verfügbare Vertrauensperson minimieren Unsicherheit und Angst bei den Patienten. Die MoniKa ist eine Ansprechpartnerin, der die Patienten vertrauen. Häufig suchen Patienten die Arztpraxis dadurch seltener auf.
Wo sehen Sie weitere Vorteile des Konzepts?
Mülleneisen: Das organisatorische Back-up, das die MoniKa liefert, ist nicht zu unterschätzen. Zum Beispiel ist der Dschungel des Sozialversicherungsrechts gerade für schwerkranke Patienten oft nicht zu durchschauen. Sie verfolgen häufig ihre berechtigten Ansprüche nicht weiter, gerade auch ausländische Mitbürger. Die MoniKa kann eine wichtige Unterstützung sein. Sie hat den Überblick über eine Flut von Hilfsmitteln, die ich überhaupt nicht kenne.
Das ist der Blick der Patienten – wie sieht es mit den Ärzten aus?
Mülleneisen: Wir müssen Strukturen schaffen, um uns Ärzte zu entlasten, damit wir uns auf das Medizinische konzentrieren können. Dabei hilft die MoniKa. Das ist nicht zuletzt bei der Suche nach Nachfolgern ein wichtiger Faktor.
Meyer zu Altenschildesche: Ein zusätzlicher medizinisch und auch versorgungstechnisch versierter „Fuß in der Tür der Patienten“ bedeutet eine bessere Versorgung, aber auch eine große zeitliche Entlastung der Ärzte. Zudem ist die gute Zusammenarbeit mit der Krankenkasse eine positive Erfahrung. Wir haben einen guten Austausch.
Glauben Sie, dass man „Mambo“ in der Breite ausrollen kann?
Mülleneisen: Ich bin sehr überzeugt davon, dass das Konzept funktioniert und dass die Evaluation gute Ergebnisse zeigen wird. Natürlich muss man das Projekt anpassen, wenn es in die Regelversorgung überführt wird. „Mambo“ gibt das aber auf jeden Fall her.
Meyer zu Altenschildesche: Angesichts der Tatsache, dass die Versorgungsprobleme zunehmen, ist Mambo ein zukunftsweisendes Projekt. Es schafft eine wirkliche Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wenn ich nicht so überzeugt von „Mambo“ wäre, würde ich keine Patienten einschreiben. Ich glaube, jeder der beteiligten Akteure hat Spaß an diesem Projekt.
Das Interview führte Ilse Schlingensiepen.