Digitale Medizin
Kommt die Sprechstunde per Smartphone?
Wie verändern E-Health und M-Health das Verhältnis zum Patienten? Das treibt viele Ärzte derzeit um. Es dominiert die Sicht auf die Chancen - denn mit der Elektronik bietet sich die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die bisher durchs Raster gefallen sind.
Veröffentlicht: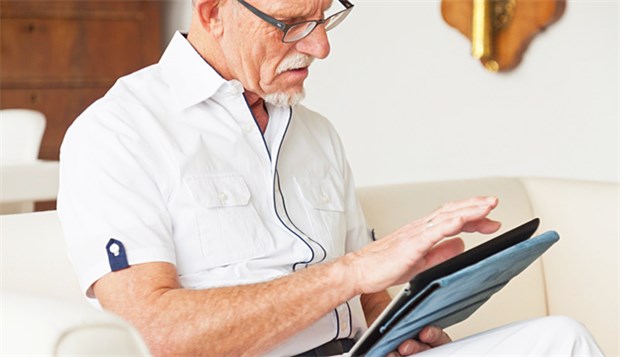
Per Touchscreen können Patienten unter anderem täglich ihre Symptome mitteilen.
© ysbrandcosijn / fotolia.com
Unter E-Health versteht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) "den Transfer gesundheitlicher Ressourcen und medizinischer Versorgung mit elektronischen Mitteln". M-Health bezeichnet den mobilen Umgang damit, wie ihn etwa Smartphones oder Tabletcomputer ermöglichen.
Solche technischen Hilfen, da sind sich Experten einig, könnten den Zugang zu schwer erreichbaren und unterversorgten Patientengruppen erleichtern.
Schwer erreichbar und mangelhaft versorgt: Das sind Merkmale, die nicht zuletzt auf Suchtpatienten zutreffen. Kein Wunder also, dass E- und M-Health kürzlich auf dem Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin in München zu den großen Themen gehörten.
Speziell damit befasst hat sich Michael Krausz, der bis vor zehn Jahren dem Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf vorstand und inzwischen als Professor für Psychiatrie und Public Health an der University of British Columbia in Vancouver tätig ist.
Er prophezeit: "Ein relevanter Prozentsatz suchtmedizinischer und psychiatrischer Versorgung wird in den kommenden zehn Jahren über das Web und soziale Medien verbreitet werden."
Krausz verweist darauf, dass international nur etwa zehn Prozent der Patienten im psychosozialen Bereich von Experten versorgt werden. Internet und soziale Medien sieht Krausz als Instrumente, mit denen sich die Zugangsschwelle zur Versorgung senken lässt. Wie wichtig das wäre, belegen Zahlen.
Laut Krausz werden nur zehn Prozent der Alkoholabhängigen so behandelt, wie es die einschlägigen Leitlinien vorsehen. Damit belegt dieses Indikationsgebiet einen der hinteren Ränge.
Zum Vergleich: Bei Patienten mit Katarakt beispielsweise kämen rund 70 Prozent in den Genuss einer an den Leitlinien orientierten Therapie, so Krausz.
Online-Raucherentwöhnung weit verbreitet
Prävention und Frühintervention beim Substanzmissbrauch liegen vor allem dort brach, wo es am wichtigsten wäre: bei den jungen Männern, die so gut wie gar nicht durch die herrschenden Strukturen erreicht werden.
Von den ersten Symptomen einer Suchterkrankung bis zur ersten professionellen Intervention vergeht deshalb viel Zeit. Zehn Jahre veranschlagt Krausz dafür und meint: "Das ist das Gegenteil von einer Frühintervention."
Die derzeit am weitesten verbreitete Online-Suchttherapie ist die Raucherentwöhnung. Vorbildcharakter haben auch Programme wie Deprexis, das in der Behandlung von Patienten mit Depressionen eingesetzt wird (Infos: www.deprexis.de).
Weitere Beispiele sind Snow Control (Kokainsucht), Down Your Drink (Alkoholabhängigkeit) oder der PTSD-Coach (eine App für Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung).
Für Alkoholabhängige existiert in Deutschland ein Online-Therapieangebot der Asklepios-Kliniken Hamburg (www.weniger-trinken-online.de). Soweit es Substanzabhängigkeit betrifft, zielen die Angebote mehr auf kontrollierten Konsum als auf Abstinenz.
Worum es letztlich geht, ist eine Veränderung der Kommunikationsstrukturen zwischen den Patienten, ihren Familien und den verschiedenen Versorgern. Das Behandlungsspektrum soll in Richtung einer frühen Erkennung und Intervention erweitert werden.
Eine besondere Rolle spielt dabei die erwähnte M-Health. Denn zumindest jüngere Menschen verschaffen sich mittlerweile überwiegend über mobile Endgeräte Zugang zum Netz.
Funktionieren soll das alles nach dem Konzept einer Art virtueller Klinik, wo Patienten über eine Online-Plattform im Zuge von automatisierten Screenings diagnostiziert und anschließend hinsichtlich ihres Substanzkonsums kontrolliert werden können. Ebenfalls online erfolgen der Zugang zur Therapie sowie die Dokumentation.
"Die Dinge, mit denen der normale Versorger 60 bis 70 Prozent seiner Zeit verbringt, sind darüber ganz anders zu organisieren", meint Krausz, der gerade an einem Pilotprojekt nach diesem Muster arbeitet.
Therapie ohne direkten Kontakt kaum möglich
Weniger flexibel als die eingesetzten Geräte sind freilich die Rahmenbedingungen, zumal in Deutschland. Dr. Christoph von Ascheraden, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer und Vorsitzender des Ausschusses "Suchtmedizin" der Landesärztekammer Baden-Württemberg, verweist auf die Berufsordnung für Ärzte.
Dort heißt es etwa unter § 7 Abs. 4: "Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch Beratung, nicht ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchführen. Auch bei telemedizinischen Verfahren ist zu gewährleisten, dass eine Ärztin oder ein Arzt die Patientin oder den Patienten unmittelbar behandelt."
Diagnose und Therapie ohne direkten Kontakt sind damit kaum möglich. Auf dem Weg in die virtuell-digitale Zukunft von Kliniken und Praxen stehen also durchaus noch ein paar ganz real-analoge Hürden, die erst einmal überwunden werden müssen.






