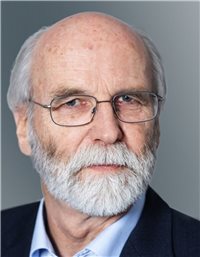Studie belegt
Gentherapie punktet bei Immundefizienz
Von einer Gentherapie profitieren Patienten mit angeborenem Immundefekt mehr als von einer Stammzelltransplantation, wie eine aktuelle Studie zeigt. Diese Erkenntnis könnte der Gentherapie zum Durchbruch verhelfen.
Veröffentlicht:
Bei Patienten mit angeborenem Immundefekt wirkt die Gentherapie, zeigt eine neue Studie.
© Gernot Krautberger / fotolia.com
PARIS. Vor mehr als 25 Jahren meldeten US-Pioniere der Gentherapie bei Patienten mit angeborenem Immundefektsyndrom (SCID; severe combined immune deficiency syndrome) die erfolgreiche Behandlung des damals vier Jahre alten Mädchens Ashanthi DeSilva.
Es war die erste, von der US-Behörde FDA zugelassene Gentherapie. Inzwischen gibt es mehr als 2000 Gentherapie-Studien, die meisten davon in Nordamerika (fast 1400) und über 520 in Europa.
Langjährige Erfahrungen haben auch französische Ärzte um Dr. Fabien Touzot und Dr. Marina Cavazzana von der Necker-Kinderklinik in Paris. Sie haben jetzt eine Vergleichsstudie gemacht, in der sie den Erfolg einer Gentherapie mit dem der Stammzelltransplantation verglichen haben (Blood 2015; online 13. April).
Dafür wurden Befunde von 27 Kindern ausgewertet, die von 2000 bis 2013 wegen einer X-Chromosom-gekoppelten schweren kombinierten Immundefizienz (SCID-X1) an der Klinik gentherapeutisch (n = 14) oder mithilfe einer haploidenten Stammzelltransplantation (n = 13) behandelt worden waren. Die Stammzellspender waren jeweils Vater oder Mutter der Patienten.
Keine T-Lymphozyten und Killerzellen
Alle Kinder (ein bis elf Monate alt) hatten einen Defekt im Gen IL2RG mit dem Bauplan für die Gamma-Kette des IL-2-Rezeptors. In Folge fehlen die T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen. Für die Gentherapie wurde ex vivo das intakte Gen mithilfe nicht vermehrungsfähiger Retroviren in CD34-positive hämatopoetische Zellen eingeschleust und die Zellen danach reinfundiert.
Anfangs waren bei vier Patienten T-Zell-Leukämien nach der Verwendung der ersten Generation des Genvektors zwischen 2,5 und fünf Jahren nach der Behandlung aufgetreten. Die Ärzte änderten dann die Gentherapietechnik 2010, wodurch es nicht mehr zu dieser unerwünschten Wirkung kam.
Ergebnis: Die Gentherapie gegen SCID war erfolgreicher als die Stammzelltransplantation. Unter anderem wurde die Normalisierung der Immunzellen binnen sechs Monaten nach der Behandlung bestimmt. Das war nach der Gentherapie bei 78 Prozent, in der Vergleichsgruppe dagegen nur bei 26 Prozent der Fall.
Darüber hinaus dauerte es nach der Gentherapie weniger lang, bis keine Zeichen einer BCG-Infektion mehr vorlagen als nach der Stammzelltransplantation (11 versus 25,5 Monate).
Normalisierung der T-Zellzahlen
Auch war die Zahl der CD3-, CD4- und CD8-positiven T-Zellen in der Gentherapiegruppe sechs und zwölf Monate nach der Behandlung signifikant höher. Nach fünf Jahren hatten sich bei sieben Gentherapie-Patienten und neun Patienten mit Stammzelltransplantation die T-Zellzahlen normalisiert.
Die Funktion der Lymphozyten hatte sich ein Jahr nach der Gentherapie bei signifikant mehr Patienten normalisiert als in der Vergleichsgruppe (elf von elf versus vier von zehn). In beiden Gruppen starben jeweils zwei Patienten innerhalb des Untersuchungszeitraums.
In der Gentherapiegruppe starb ein Patient vier Monate nach der Therapie an den Folgen einer Adenovirusinfektion, ein weiterer an den Folgen einer chemoresistenten lymphoblastischen T-Zell-Leukämie fünf Jahre nach der Gentherapie.
Dieser Patient gehörte noch zu jenen mit der Gentherapie der ersten Generation. Ein Patient mit haploidenter Stammzelltransplantation starb sechs Monate später an einer viralen Atemwegsinfektion, der andere Patient sieben Jahre später an einer Enteropathie aufgrund des Immundefekts.
Touzot und seine Kollegen erinnern daran, dass nach Verbesserung des Genvektors keine gentoxischen Effekte mehr aufgetreten seien. Sollten sich die ermutigenden Ergebnisse auch über einen längeren Zeitraum bestätigen, halten sie die Gentherapie im Vergleich zur haploidenten Stammzelltransplantation mindestens für ebenbürtig. Möglicherweise könnte sie auch eine Alternative sein.
Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Heilsamer Schock