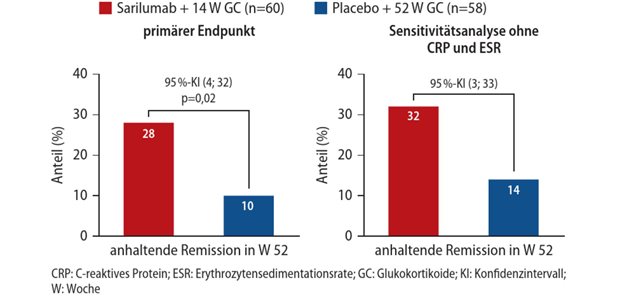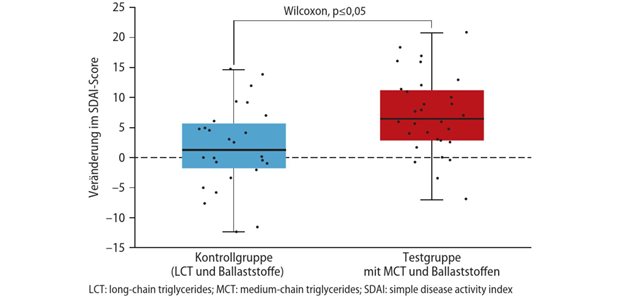Frakturen
Implantat steuert Heilung von Brüchen
Ein intelligentes Implantat soll bei Frakturen sofort ab der Op die Heilung überwachen und bei Fehlbelastung warnen.
Veröffentlicht:Homburg. Ein intelligentes Implantat soll bei Frakturen sofort ab der Op die Heilung überwachen und bei Fehlbelastung warnen.
Es soll selbst aktiv durch Bewegungen gegensteuern, wenn nicht zusammenwächst, was zusammengehört: Das ist das Ziel von Forschern der Universität des Saarlandes unter Leitung des Unfallchirurgen Professor Tim Pohlemann.
Das Team um Pohlemann will die Therapie bei komplizierten Frakturen revolutionieren, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Werner Siemens-Stiftung und der Universität heißt. Die Stiftung fördert die Forschungen mit acht Millionen Euro. Dies solle den Patienten schneller wieder auf die Beine helfen und zugleich die Behandlungskosten senken.
Schmerzen und massive Einschränkungen
„Neben den Schmerzen und den massiven Einschränkungen, die ein solcher Bruch mit sich bringt, kann die Therapie im ungünstigen Fall schnell Kosten in sechsstelliger Höhe verursachen“, wird Pohlemann zitiert.
Die Idee: Ein speziell auf die einzelnen Patienten zugeschnittenes Implantat soll nach der Op automatisch Informationen darüber liefern, wie die Bruchstelle verheilt, und außerdem gezielt und aktiv die Knochenheilung positiv beeinflussen, indem es sich von selbst nach Bedarf bewegt oder versteift.
„Wir haben in Vorstudien herausgefunden, dass Frakturen schneller heilen, wenn die Bruchstelle durch Bewegung stimuliert wird. Unsere Vision ist – salopp gesagt – ein Implantat, das Tag und Nacht die optimale Krankengymnastik macht und so den Knochen schneller und besser heilen lässt“, erklärt Pohlemann in der Mitteilung.
Das Implantat soll warnen
Auch soll das Implantat warnen, wenn etwa der Knochen zu stark belastet wird. In spätestens fünf Jahren soll ein Implantat-Prototyp entwickelt sein. Hierzu kombinieren die Wissenschaftler modernste Materialtechnik, Künstliche Intelligenz und medizinisches Know-how.
Unterschenkelfrakturen, als bekannt komplexe Verletzung, dienten als Versuchsfall. Bereits seit langem arbeiten die Forscher daran, herauszufinden, wie genau sich nach einer Fraktur die Belastung beim Gehen auf die Heilung auswirkt. So erfassten sie mit Sensor-Einlegesohlen über lange Zeit bei jedem Schritt von Patienten 60 verschiedene Parameter.
Zudem wurden Daten gesammelt von Knochen, die erst gebrochen und dann vielfältig belastet werden. Und unzählige Computertomographien wurden ausgewertet.
Belastungsmuster erkennen
Vor allem, was bei Belastung im Frakturspalt passiert, interessiert die Forscher. „Wenn wir wissen, wie die Lastverteilung im spezifischen Bruch sein wird, welche Kräfte hier wirken, können wir berechnen, wie das Implantat für die individuelle Frakturgeometrie aussehen muss, oder auch, wie viele Schrauben tatsächlich an welcher Stelle notwendig sind“, erläutert der Ingenieur Professor Stefan Diebels in der gemeinsamen Mitteilung der Werner Siemens-Stiftung und der Universität.
Mit Methoden Künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens erstellen sie aus den so gewonnenen Daten Belastungsmuster, anhand derer sie Rückschlüsse auf Heilung oder Störungen ziehen können. Spezialisten für intelligente Materialsysteme um Professor Stefan Seelecke arbeiteten daran, die Implantate aus dem intelligenten Material Nickel-Titan, auch Nitinol genannt, herzustellen: Haarfeine Drähte aus dieser für den Körper ungefährlichen Legierung werden auch künstliche Muskeln genannt und könnten sich mithilfe elektrischer Signale exakt bewegen, heißt es.
„Von allen Antriebsmechanismen haben diese Muskeldrähte die höchste Energiedichte und können auf kleinem Raum kraftvolle Bewegungen ausführen“, wird Seelecke zitiert.
Sensoreigenschaften sind mit ihnen automatisch integriert. „Die Drähte liefern alle Daten. Mit ihren sensorischen Eigenschaften können wir sie einsetzen, um die Bruchstelle gezielt, autonom und smart durch Bewegung zu stimulieren.“ (eb)