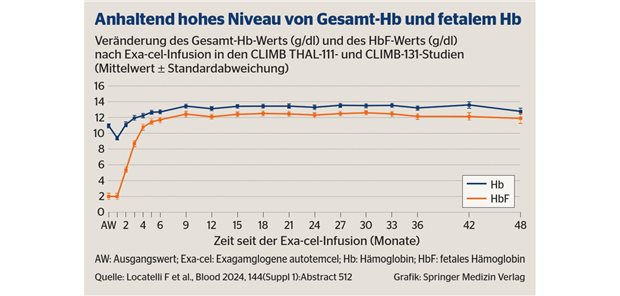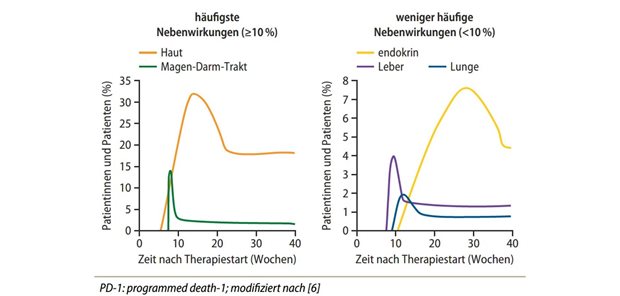Akute myeloische Leukämie
MRD-Überwachung könnte das Leben einer Subgruppe von AML-Patienten verlängern
Ein hochsensitiver Knochenmarktest – die Bestimmung der messbaren Resterkrankung – verlängert womöglich das Leben einiger junger Erwachsener mit akuter myeloischer Leukämie und bestimmten molekularen Veränderungen. Der Test könnte Kolleginnen und Kollegen helfen, ein Rezidiv früh zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern.
Veröffentlicht: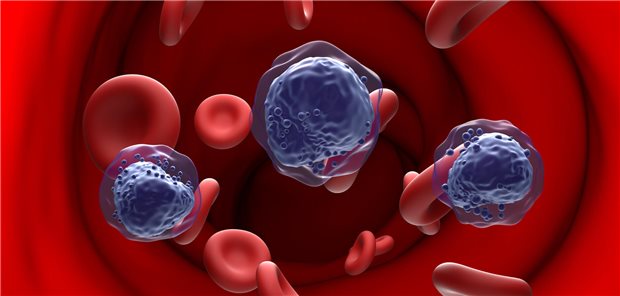
Tumorzellen im Blut: Die messbare Resterkrankung, das heißt wenige Tumorzellen in Blut oder Knochenmark, ist ein starker prognostischer Marker bei der AML. Sie kann mit verschiedenen Methoden gemessen werden, unter anderem Mehrfarben-Durchflusszytometrie und quantitativer Real-time-PCR.
© LASZLO / stock.adobe.com
London. Wird eine messbare Resterkrankung (MRD) nach einer kurativen Therapie bei Patientinnen und Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) nachgewiesen, so ist das meist mit einer schlechten Prognose assoziiert. Bei der MRD handelt es sich um eine geringe Anzahl verbleibender Tumorzellen in Blut oder Knochenmark, die mit verschiedenen Methoden gemessen werden können.
Forschende um Dr. Nicola Potter, King´s College London, prüften in ihrer Studie, ob eine Überwachung mittels MRD-Analyse und eine auf deren Ergebnisse angepasste Therapie die Prognose der Betroffenen verbessern kann (Lancet Haematol 2025; online 29. April). Denn damit lassen sich womöglich Rezidive früher erkennen und entsprechend gegensteuern.
Tatsächlich konnten die Autoren das für eine bestimmte Subgruppe mit NPM1-Mutationen und FLT3-interne Tandem-Duplikationen (FLT3-ITD) bestätigen: Hier verlängerten die regelmäßigen Tests und Therapieanpassungen das Überleben signifikant. Sowohl Mutationen im NPM1-Gen als auch FLT3-ITD sind häufige Genalterationen bei der AML.
Frühe Erkennung eines Rezidivs ist entscheidend
„Die akute myeloische Leukämie ist die aggressivste Form von Blutkrebs. Daher ist es entscheidend, früh zu wissen, ob der Krebs eines Patienten zurückkehren wird, um die Behandlung entsprechend zu planen“, wird Dr. Richard Dillon, Seniorautor und Klinischer Senior Lecturer für Krebsgenetik am King’s College London, in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir hoffen, dass diese Tests Teil der routinemäßigen Versorgung für diese Krebsart (…) werden und letztendlich die langfristigen Überlebensraten der Patienten verbessern.“
Die Daten stammten aus zwei randomisierten, kontrollieren Phase-III-Studien, in die Erkrankte mit neu diagnostizierter AML zwischen 16 und 60 Jahren eingeschlossen waren. Insgesamt 637 Patientinnen und Patienten, die bestimmte Genveränderungen hatten, zum Beispiel NPM1-Mutationen, wurden 2:1 randomisiert: Bei der einen Gruppe führten die Forschenden während der Therapie und drei Jahre danach kontinuierlich eine MRD-Analyse durch, die andere erhielt eine Standardversorgung ohne molekulares Monitoring.
In der Überwachungsgruppe entschieden die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, ob und wie sie die MRD-Ergebnisse in die Therapie einbezogen, einschließlich bei Fällen eines MRD-Rezidivs. Basierend auf der MRD wurde bei 133 (42 %) von 314 Patienten die Behandlung angepasst. Dies stellte auch gleichzeitig eine Limitation der Studie dar: Die Behandelnden konnten frei über die Therapieänderung entscheiden und die Anpassungen wurden nicht prospektiv dokumentiert.
Risiko für den Tod verringert sich um die Hälfte
Im Gesamtkollektiv unterschied sich das Drei-Jahres-Gesamtüberleben (OS) mit 70 Prozent versus 73 Prozent nicht zwischen der kontinuierlichen MRD-Überwachung und der Kontrollgruppe. Eine Meta-Analyse der beiden Studien ergab ebenfalls keine Unterschiede im OS, mit einer Hazard Ratio von 1,11 (p = 0,25).
Untersuchten die Forschenden allerdings die Subgruppe der Teilnehmenden mit NPM1-Mutationen und FLT3-ITD, so hatten diejenigen mit MRD-Überwachung einen Überlebensvorteil (69 Prozent versus 58 Prozent). Das Risiko, zu sterben, verringerte sich damit um fast die Hälfte (HR 0,53; p = 0,021).
Aktuelle Leitlinien weisen zwar auf die Vorteile einer MRD-Überwachung für AML-Patientinnen und -Patienten mit einem molekularen Marker hin; allerdings gab es bisher keine Studien, die untersuchten, ob diese Praxis die Überlebensrate verbessert, schreiben die Forschenden abschließend. Ob man die Ergebnisse auf ältere Personen und solche, die weniger intensive Chemotherapien erhalten, übertragen kann, müsse man noch prüfen.
Zielgerichtete Therapien nicht mit einbezogen
Die wichtigste Limitation der Studie: Sie wurde zwischen 2012 und 2018 durchgeführt, als nur wenige zielgerichtete Therapien für ein MRD-Rezidiv zur Verfügung standen. Aus diesem Grund erhielten die meisten eine Salvage-Chemotherapie – deren Nutzen wiederum kürzlich infrage gestellt wurde, da sich kein Vorteil gegenüber einer direkten Transplantation bei Erkrankten mit klinischem Rezidiv ergeben hatte.
Es wäre verfrüht, die MRD-Überwachung für Subgruppen andere als diejenigen mit NPM1-Mutationen und FLT3-ITD aufzugeben, meinen die Autoren. Das gelte insbesondere für Gruppen, für die effektive zielgerichtete Therapien verfügbar sind.