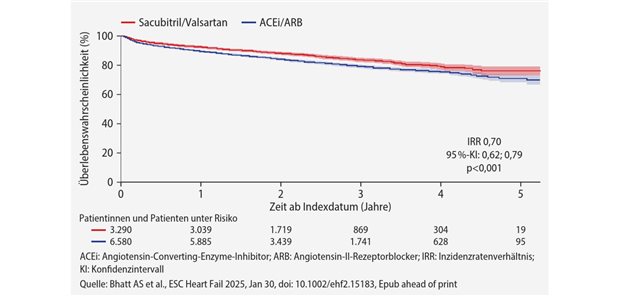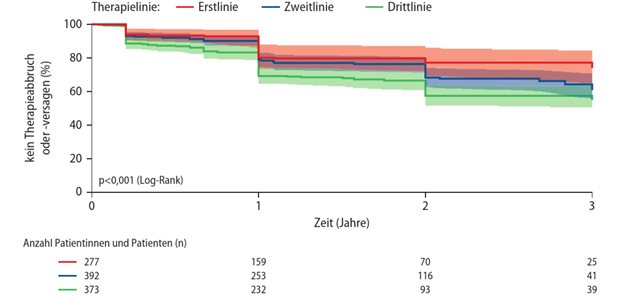Bei Therapie berücksichtigen
Psychosoziale Versorgung ist auch bei Diabetes mehr als ein Add-on!
Die Lebensqualität und die Stoffwechseleinstellung bei Diabetes hängen stark von den psychosozialen Begleitumständen ab. Beratungsanlässe gibt es zuhauf. Spezialisierte Therapeuten werden seit langem ausgebildet. Doch die Versorgung reicht weiterhin nicht aus.
Veröffentlicht:
Verzweifelt und antriebslos: Die psychische Verfassung wirkt sich stark auf die Stoffwechselkontrolle bei Diabetes aus (Symbolbild mit Fotomodell).
© AlexanderNovikov / stock.adobe.com
Die Psyche wird gern wie ein Anhängsel somatischer Krankheiten betrachtet. Irgendwie sei ja nachvollziehbar, dass sich eine chronische Erkrankung auch auf die Seele auswirke. Also müsse das Psychosoziale – zusätzlich zum Primat der somatischen Behandlung – wohl therapeutisch mitbedacht werden. Ob Herzinfarkt, COPD oder Diabetes mellitus, das können wir uns doch leisten, so viel Luxus sollte eine moderne Medizin sich auch noch gönnen. Ernsthaft?
Manchmal hilft ein Perspektivwechsel: Aus Sicht von Grundlagenforschern teilen Diabetes und Depressionen einige biologische Ursprünge. Genannt werden ein überaktiviertes angeborenes Immunsystem, resultierend in einer Zytokin-vermittelten Entzündungsreaktion. Der endokrine Regelkreis von Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinden (HPA-Achse) arbeitet fehlerhaft, Stress aktiviert die HPA-Achse. Hyperkortisolismus und Insulinresistenz sind die Folgen.
Strukturelle Gehirnveränderungen
Die Entzündungsmediatoren wirken womöglich direkt auf das Gehirn. Das könnte mit ein Grund dafür sein, warum Depressionen zweimal so häufig bei Menschen mit Diabetes vorkommen wie in der Allgemeinbevölkerung. Sowohl Typ-1-Diabetes wie auch Typ-2-Diabetes haben strukturelle Gehirnveränderungen zur Folge, wie aus Neuroimaging-Studien hervorgeht.
Ein Missverhältnis von ausgeprägtem Arbeitsstress, kleiner Vergütung und geringen Karriere-Chancen wirkt sich negativ auf den Glukosestoffwechsel aus, wie gerade eine dänische Studie ergeben hat (J Psychosom Research 2020; 128: 109867).
Seit mehreren Dekaden sei bekannt, dass psychologische und soziale Faktoren in der Ätiopathogenese des Typ-2-Diabetes eine zentrale Rolle spielen, berichten Professorin Karin Lange von der Medizinischen Hochschule Hannover und ihre Kollegen im „Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2021“.
Psychisches Befinden und Qualität der Stoffwechseleinstellung beeinflussen sich gegenseitig in vieler Hinsicht. So ist das Selbstmanagement von Diabetespatienten abhängig von Kognition, Sozialstatus und Familienstrukturen, von sozialer Unterstützung sowie affektiven Einflüssen und psychischen Komorbiditäten. „Niemand ist alleine krank“, betonen Lange und ihre Koautoren, besonders mit Blick auf Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes. Deren Erkrankung beeinflusst das Leben ganzer Familien.
Misserfolge bei der Stoffwechselkontrolle können in einen Teufelskreis münden: Längerfristige Dysglykämie beeinträchtigt die Kognition und die emotionale Stabilität, dies schränkt die Fähigkeit zur Therapiesteuerung ein mit der Folge weiter bestehender Dysglykämie. „Erhöhte HbA1c-Werte und akute Komplikationen werden als persönliche Niederlagen wahrgenommen und verstärken Selbstzweifel, fördern Resignation und erlernte Hilflosigkeit sowie Leugnung des Risikos“, heißt es im Gesundheitsbericht.
Subklinische psychische Belastungen erschweren die Therapie. Das trifft erst recht zu auf manifeste psychische Erkrankungen wie hyperkinetische Störungen, Zwänge, Ängste oder Essstörungen. Soziale Ungleichheit oder mangelndes Sprachverständnis bedingen spezifischen Unterstützungsbedarf.
Integraler Bestandteil der Therapie
Ergo kann und muss die psychosoziale Versorgung nicht nur als „Add-on“, sondern als integraler Bestandteil der Diabetestherapie betrachtet werden, so die Forderung im Gesundheitsbericht Diabetes, und zwar in allen Sektoren von der ambulanten Versorgung bis zu Rehabilitation. Die Arbeitsgemeinschaft „Diabetes und Psychologie e.V.“ der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) bildet zwar seit über 20 Jahren Fachpsychologen und Psychodiabetologen aus.
Doch die psychosoziale Versorgung von Diabetes-Patienten wird als oft unzureichend beschrieben. Die 2017 etablierte Weiterbildung „Spezielle Psychotherapie Diabetes“ der Bundespsychotherapeutenkammer ist bislang nur in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz umgesetzt.
Das ist interessant, denn als Erstes zu erwarten gewesen wäre dies vor allem in Bundesländern mit den anteilsmäßig meisten Diabetes-Patienten, also in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Psychosoziale Versorgung – eben doch eine Frage des Wohlstands? Tatsache ist, dass Fort- und Weiterbildungen zu psychodiabetologischen Themen gefragt sind. An Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft „Diabetes und Psychologie“ haben nach eigenen Angaben bislang über 500 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen.
Und der Bedarf aufseiten der Patienten ist auf jeden Fall vorhanden, die Liste potenzieller Beratungsanlässe ist lang: Die lebenslange Erkrankung muss akzeptiert, Schuldgefühle sollen bewältigt, Hürden bei der Integration in Schule und Kinder-Tageseinrichtungen überwunden werden. Therapienotwendigkeiten und persönliche Bedürfnisse stehen in einem Spannungsverhältnis. Es geht um Überforderung, um Erziehungsfragen, um Sorgen und Ängste vor Komplikationen, die Bewältigung von Folgeerkrankungen.
Die Resignation angesichts verfehlter Therapieziele, finanzielle Probleme, Arbeitslosigkeit, Partnerschaftskonflikte, Hilflosigkeit, Essstörungen, Zwänge, Depression, Abhängigkeit, Folgen des geriatrischen Syndroms – all das beeinflusst den Diabetesverlauf.
Regelmäßiges Screening hilfreich
Daher sprechen sich die Experten im Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes für regelmäßige psychosoziale Screenings aus. Diese können abhängig vom Alter, vom Diabetesstadium oder der aktuellen Lebenssituation erfolgen. Sensible Phasen sind schwere akuten Komplikationen oder kritische Lebensereignisse. „Einige Themen können während der regelmäßigen ambulanten Vorstellungen einfühlsam in der Anamnese erfragt werden“, schreiben Lange und Kollegen.
Des Weiteren verweisen sie auf kurze und validierte Screening-Instrumente, die unter www.diabetes-psychologie.de zur Verfügung gestellt werden, etwa zu Wohlbefinden, Angst, Depression, Diabetes-bezogenem Distress oder Essstörungen.
So umfasst der WHO-Fragebogen zum Wohlbefinden lediglich fünf Fragen, die mit Punkten bewertet werden. Ausführlicher ist die PAID-Skala mit 20 Fragen zu derzeitigen Problemen, die mit jeweils 0 Punkten (kein Problem) bis 4 Punkten (großes Problem) in die Bewertung eingehen. Jeder Wert ab 2 Punkten sollte in der Beratung oder Schulung angesprochen werden. Bei einem Score von mehr als 39 Punkten besteht der Verdacht auf eine klinisch bedeutsame depressive Verstimmung.
Beratungen und Coachings nötig
Um identifizierte Probleme bewältigen zu können, sind Beratungen und Coachings notwendig, die zum Teil Inhalt der Schulungen im Disease Management Programm sind. Einzelne Krankenkassen unterstützen telemedizinische Beratungen, um notwendige Lebensstiländerungen zu fördern.
So ist es zum Beispiel mit dem telemedizinischen Lebensstil-Interventionsprogramm TeLIPro in einer Interventionsstudie gelungen, den HbA1c-Wert bei übergewichtigen und adipösen Patienten mit Typ-2-Diabetes signifikant stärker zu senken als in einer Kontrollgruppe, deren Teilnehmer lediglich Schrittzähler sowie eine allgemeine Beratung erhalten hatten (Diabetes Care 2017; 40: 863–871).Das Programm wird vom Deutschen Diabetes Zentrum in Düsseldorf derzeit weiterentwickelt.
Eine ganze Reihe der oben genannten Beratungsanlässe erfordert individuelle Coachings durch entsprechend ausgebildete Psychologen und Sozialarbeiter. Der Haken dabei ist, dass die meisten Beratungsanlässe nicht zu den Indikationen für eine psychotherapeutische Behandlung zählen, merken Lange und Kollegen an. Denn dies setze eine entsprechende ICD-10-Diagnose voraus.
„Einige Beratungsanlässe ermöglichen dagegen eine ICD-10-relevante psychotherapeutische Unterstützung (F54.0).“ Dies ist der Fall, wenn sich psychologische Faktoren negativ auf die Lebensqualität der Patienten und deren Stoffwechseleinstellung auswirken. Bei diesen sowie bei Patienten, die aufgrund einer psychischen Erkrankung psychotherapeutische oder psychiatrische Hilfe benötigen, sollen Therapeuten die Rolle des Diabetes berücksichtigen können. Die AG „Diabetes und Psychologie e.V.“ hat auf ihrer Homepage ein entsprechendes Verzeichnis ärztlicher und psychologischer Psychotherapeuten zur Verfügung gestellt.
Kaum niederschwellige Angebote
Die Realität der psychodiabetologischen Versorgung ist heterogen. In vielen pädiatrischen Diabeteszentren ist sie zumindest für die stationäre Behandlung gesichert. Im ambulanten Setting ist sie jedoch nur in einzelnen Regionen über sozialpädiatrische Zentren oder die sozialmedizinische Nachsorge möglich.
Für erwachsene Diabetes-Patienten fehlen Abrechnungsmöglichkeiten innerhalb des DRG-Systems für die stationäre Versorgung. In einigen psychosomatischen Einrichtungen können die spezifischen Angebote für Diabetes-Patienten realisiert werden. Im ambulanten Sektor finden sich außerhalb der Diabetesschulungen keine oder unzureichend finanzierte Angebote für niederschwellige Beratungen.