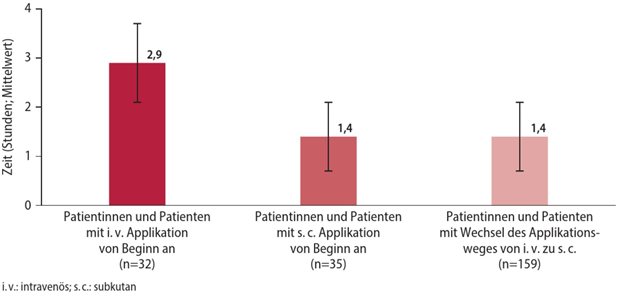Sachsen
Große Kliniken wollen Führungsrolle bei Corona-Ausbrüchen
Ist Sachsen bislang vergleichsweise gut durch die Coronavirus-Pandemie gekommen, weil die Maximalversorger eine Steuerungsfunktion hatten? Führende Vertreter der Kliniken sind davon überzeugt.
Veröffentlicht:
Die Uniklinik Leipzig ist einer von drei Maximalversorgern in Sachsen. Die drei großen Kliniken würden auch bei weiteren Corona-Ausbrüchen gerne eine Steuerungsfunktion übernehmen.
© Sebastian Willnow/picture alliance/dpa
Leipzig. Die drei Kliniken der Maximalversorgung in Sachsen wünschen sich für weitere Corona-Ausbrüche im Freistaat einen Sicherstellungsauftrag von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD).
Das wurde bei einem Online-Symposion zur Coronavirus-Pandemie in Sachsen mit rund 200 Teilnehmern deutlich, das das Universitätsklinikum Leipzig zusammen mit dem Klinikum Chemnitz, der Universitätsklinik Dresden und der sächsischen Landesärztekammer organisiert hatte.
„Die regionale Steuerung und Selbststeuerung ist wichtig und sollte beibehalten werden“, sagte Andreas Mogwitz, medizinischer Geschäftsleiter der Dresdner Uniklinik. „Wir brauchen einen Sicherstellungsauftrag für unsere drei Kliniken vom Gesundheitsministerium für die Steuerungsfunktion der Kliniken.“
„Verteilung der Patienten hat gut funktioniert“
Damit griff Mogwitz einen Aspekt auf, den zuvor der medizinische Vorstand des Leipziger Uniklinikums, Professor Christoph Josten, dargestellt hatte. Josten hatte berichtet, dass es bei der ersten Corona-Welle einen Auftrag von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) an die drei Maximalversorger in Chemnitz, Dresden und Leipzig gegeben hatte, jeweils für die drei Regionen Netzwerke zu bilden und die Steuerungsfunktion für die Behandlung von Patienten mit COVID-19 zu übernehmen.
Darin sahen Josten, Mogwitz sowie der Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz, Dr. Thomas Grünewald, einen entscheidenden Grund dafür, dass Sachsen die Corona-Pandemie bisher vergleichsweise gut bewältigt habe.
„Wir konnten die Patientenströme koordinieren und die Patienten entsprechend ihrer Krankheitsschwere versorgen“, berichtete Josten. „Wir hatten in unseren drei Regionen außerdem zahlreiche coronafreie Krankenhäuser, da wir die Behandlung von Patienten mit COVID-19 jeweils auf mehrere spezialisierte Kliniken konzentriert haben.“
„Keine Klinik war überfordert“
Josten machte in der Bildung der Netzwerke einen großen Vorteil aus, weil so ein ständiger Austausch zwischen allen Krankenhäusern in der jeweiligen Region möglich gewesen sei und es darüber hinaus habe verhindert werden können, dass einzelne Kliniken mit der Behandlung von zu vielen Patienten mit COVID-19 überfordert werden könnten.
„Wenn zum Beispiel ein einzelner Landkreis auf sich allein gestellt ist und dann im Landkreis entschieden wird, COVID-19-Patienten nicht in andere Kliniken mit weniger Fällen zu verlegen, dann kann eine erhöhte Sterblichkeit an COVID-19 entstehen“, führte Josten aus. „Wir konnten Kliniken mit vielen COVID-19-Patienten entlasten“, schilderte Grünewald.
In der Region Chemnitz gab es vor allem in Zwickau sowie dem Erzgebirge und dem Vogtland viele Corona-Fälle. „Wir sollten die Chance nutzen, unsere Strukturbildung langfristig zu erhalten und vorzuhalten“, fügte Grünewald an.
Der Präsident der sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, brachte Vorschläge für die Arbeit von niedergelassenen Ärzten während der Corona-Pandemie ein. „Die Hygienepläne in den Arztpraxen sollten um die Behandlung infektiöser Patienten ergänzt werden“, schlug er vor.
Infektiöse Patienten sollten außerdem vor allem zu den Sprechstundenrandzeiten einbestellt werden und möglichst in speziellen Räumen der Praxis untersucht und behandelt werden.
LÄK-Präsident appelliert: Videosprechstunden üben
Darüber hinaus plädierte Bodendieck dafür, „Videosprechstunden und Videokonferenzen auch in guten Zeiten der Nicht-Katastrophe zu nutzen und einzuüben, damit sie in einer Krisensituation sofort eingesetzt“ werden könnten.
Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV Sachsen, Sylvia Krug, schilderte, wie sich die Zahlen der Nutzung von Videosprechstunden bei niedergelassenen Ärzten in Sachsen entwickelt habe. Von Januar bis März 2019 seien 130 Videosprechstunden abgerechnet worden, von Januar bis März dieses Jahres 4771 und von April bis Juni dieses Jahres seien es 23.125 gewesen.
Sie berichtete außerdem davon, dass die KV von Januar bis März dieses Jahres im Vergleich zu den Vorjahresmonaten einen Anstieg der Besuche bei Haus- und Kinderärzten registriert habe, bei den Fachärzten jedoch einen Rückgang. Krug interpretierte dies so, dass Patienten Angst gehabt hätten, sich bei Arztbesuchen mit dem Corona-Virus anzustecken.
Kammerpräsident Bodendieck nahm die Beobachtung, dass Patienten mit chronischen Krankheiten auf notwendige Arztbesuche verzichtet hätten, zum Anlass für einen Appell: „Einen zweiten Lockdown des Gesundheitswesens können wir uns nicht leisten.“