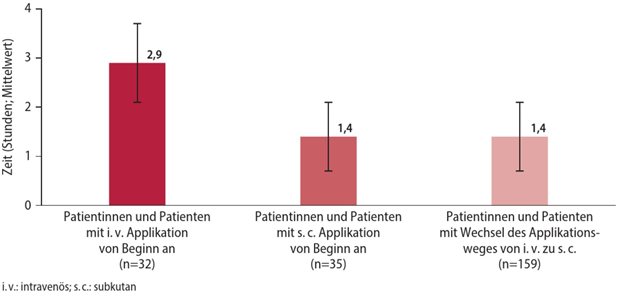Corona-Langzeitfolgen
Post-COVID-Forschung in Bayern: Regelversorgung mitdenken!
Seit Herbst 2021 fördert der Freistaat Bayern sieben Forschungsprojekte zur Versorgung Betroffener von Corona-Langzeitfolgen und setzt auf Vernetzung – eine Zwischenbilanz.
Veröffentlicht:
Nennt die bisherigen Ergebnisse der Forschungsprojekte zu Post-COVID „vielversprechend“: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).
© Sven Hoppe/dpa
München. Die „Förderinitiative Versorgungsforschung zum Post-COVID-Syndrom“ des Freistaats Bayern zielt auf eine verbesserte Versorgung Betroffener ab. Fördergelder in Höhe von insgesamt fünf Millionen Euro fließen ein Jahr lang in sieben Projekte.
Zur Halbzeit kamen Projektteilnehmer laut Mitteilung des Gesundheitsministeriums zum Netzwerktreffen am Donnerstag nach München und zogen Zwischenbilanz. Die fachliche Begleitung der Projekte erfolgt durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).
Von Anfang 2021 bis zum ersten Quartal 2022 wurden laut KV Bayerns (KVB) rund 280 .000 Long-COVID-Patienten in Bayern ambulant versorgt. Im ersten Quartal 2022 kamen rund 140 .000 neue Patienten dazu. Ein Drittel der Patienten wird längerfristig behandelt, also mindestens über zwei Quartale.
Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nannte die ersten Ergebnisse „vielversprechend“: „Die geförderten Projekte sprechen alle Bereiche von Diagnostik bis Therapie und Rehabilitation in der ambulanten und stationären Versorgung an und sollen perspektivisch auch für die Regelversorgung in Frage kommen.“
Kinder und Erwachsene im Fokus
Ein Blick auf die einzelnen Projekte:
Das Vorhaben „Post-COVID Kids Bavaria“ besteht aus zwei eigenständigen, aber synergistischen Projekten und befasst sich mit Langzeiteffekten von Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen. Niedergelassene Kinder-/Jugend- und Allgemeinärzte arbeiten mit Spezialambulanzen an ausgewählten Kinderkliniken und Kinderpsychiatrischen Kliniken in Bayern eng zusammen, um eine schnelle und lückenlose Versorgung anzubieten. Einige spezielle Untersuchungsverfahren (Immunologie, Augenheilkunde, Kinderpsychiatrie) werden zentral in Regensburg angeboten.
Schwerpunkt des Projekts „Post-COVIDLMU“ ist die Behandlung und Erforschung von komplexen und schweren Fällen des Post-COVID-Syndroms bei Erwachsenen. Die Behandlung erfolgt interdisziplinär unter Einbezug aller Fachkliniken des LMU-Klinikums. Ergänzt wird das universitäre Angebot durch telemedizinische Sprechstunden und interdisziplinäre Fallkonferenzen unter Beteiligungsmöglichkeit der zuweisenden niedergelassenen Ärzte.
Das Projekt „disCOVer“ hat sich die Entwicklung eines diagnostischen Algorithmus zur Klassifikation von Long-COVID-Patienten zum Ziel gesetzt. Ziel des Projekts „ReLoAd after COVID-19-Study“ ist es zu erforschen, welche Auswirkung ein nach dem jeweiligen Hauptsymptom ausgerichtetes Rehabilitationsprogramm auf die Lebensqualität von Post-COVID-Patienten besitzt. Drei Therapiecluster werden nach den bestehenden Hauptsymptomen Fatigue, Kognition und Soma differenziert.
Die Entwicklung eines Behandlungspfads für Erwachsene im Erwerbsalter ist Inhalt des Projekts „ASAP“. Diese sind: ein niedrigschwelliges Screening, ein interdisziplinäres Assessment, ein persönlicher Lotse als Patientenansprechpartner und digitale Therapieangebote. Mit der Verbesserung und Erforschung der gesundheitlichen Situation von Post-COVID-Patienten anhand eines integrativ-naturheilkundlichen Versorgungskonzeptes befasst sich das Projekt „Integrative Medizin und Naturheilkunde in der Behandlung des Post-COVID-Syndroms“. (mic)