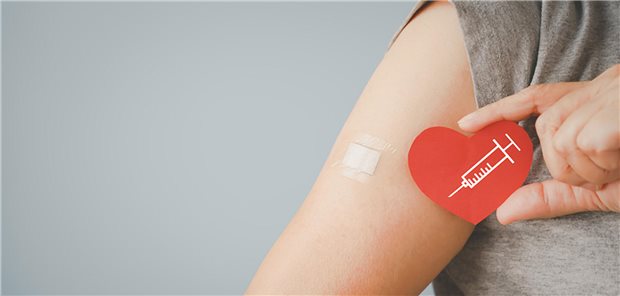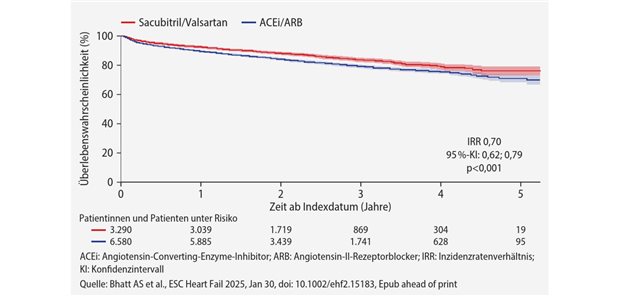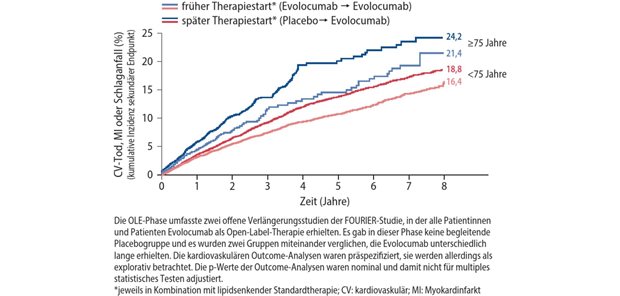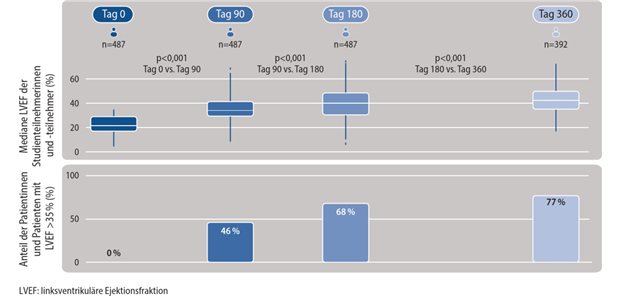EvidenzUpdate-Podcast
Lipid-Screenings für alle? Vom großen Missverständnis Früherkennung
Karl Lauterbach hat offenbar ein Herz für die Gefäße unserer Kinder – und will für alle ein flächendeckendes Lipid-Screening einführen. Ein „EvidenzUpdate“ darüber, warum das eigentlich ziemlicher Unfug ist.
Veröffentlicht:
EvidenzUpdate mit DEGAM-Präsident Martin Scherer
© [M] sth | Scherer: Tabea Marten
Ein LDL-Cholesterin deutlich über 300 mg/dl (17 mmol/l; Grüße in den Osten) und der V.a. familiäre Hypercholesterinämie (FH) steht im Raum. Geschätzt wird die Prävalenz auf 1:500, jeder fünfte Myokardinfarkt bei unter 45-Jährigen soll auf eine FH zurückgehen. Da scheint es sinnvoll, den Lipid-Profilen des Volks auf die Schliche zu kommen und Risikopersonen frühzeitig zu entdecken. So jedenfalls mutet ein Plan von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für ein Lipid-Screening innerhalb der U9-Untersuchung an.
In dieser Episode des „EvidenzUpdate“-Podcasts sprechen wir deshalb über Prävention, Vorsorge und Früherkennung. Wir diskutieren über die Kriterien von Wilson & Jungner, betrachten frühere Versuche flächendeckender Screenings und loten die Grenzen und Risiken aus. Wir überlegen, wie eine Früherkennung kardiovaskulärer Risiken funktionieren könnten. Und wir trennen Verhältnis- von Verhaltensprävention.
Im Gespräch machen wir auch ein Rechenbeispiel, was eine flächendeckende Detektion von FH kosten würde. Würde für jeden Jahrgang in der U9 eine genetische Diagnostik durchgeführt werden, müsste auf Mutationen im APOB-Gen untersucht und das LDLR-Gen und das PCSK9-Gen sequenziert werden. Nach EBM würde das je Fall (2× GOP 11511, 10× 11522, 1× 11512, 8× 11513) knapp über 1.300 Euro nur an Laborkosten verursachen. (Dauer: 40:03 Minuten)
Anregungen? Kritik? Wünsche?
Schreiben Sie uns: evidenzupdate@springer.com
Quellen
- Fricke A. Screenings und DMP-Öffnung: Lauterbach will Vorsorgemedizin in Praxen stärken. AerzteZeitung.de. 2023. https://www.aerztezeitung.de/Politik/Screenings-und-DMP-Oeffnung-Lauterbach-will-Vorsorgemedizin-in-Praxen-staerken-443514.html (accessed 17 Nov 2023).
- Staeck F. DEGAM demontiert Lauterbachs Früherkennungs-Institut. AerzteZeitung.de. 2023. https://www.aerztezeitung.de/Politik/DEGAM-demontiert-Lauterbachs-Frueherkennungs-Institut-444277.html (accessed 17 Nov 2023).
- Scherer M, Kochen M. Fundusimaging - kritische Betrachtung eines kardiovaskulären Screenings. ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin 2006;82:163–7. doi:https://doi.org/10.1055/s-2006-933381
- Luirink IK, Wiegman A, Kusters DM, et al. 20-Year Follow-up of Statins in Children with Familial Hypercholesterolemia. New England Journal of Medicine 2019;381:1547–56. doi:https://doi.org/10.1056/nejmoa1816454
- Barry MJ, Nicholson WK, Silverstein M, et al. Screening for Lipid Disorders in Children and Adolescents. JAMA 2023;330:253–3. doi:https://doi.org/10.1001/jama.2023.11330
- Qureshi N, Da Silva MLR, Abdul-Hamid H, et al. Strategies for screening for familial hypercholesterolaemia in primary care and other community settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021;2021. doi:https://doi.org/10.1002/14651858.cd012985.pub2
- Dyakova M, Shantikumar S, Colquitt JL, et al. Systematic versus opportunistic risk assessment for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016;CD010411. doi:https://doi.org/10.1002/14651858.cd010411.pub2
- Jorgensen T, Jacobsen RK, Toft U, et al. Effect of screening and lifestyle counselling on incidence of ischaemic heart disease in general population: Inter99 randomised trial. BMJ 2014;348:g3617–7. doi:https://doi.org/10.1136/bmj.g3617
- Wilson J, Jungner G. PRINCIPLES AND PRACTICE OF SCREENING FOR DISEASE. WHO 1968. https://niercheck.nl/wp-content/uploads/2019/06/Wilson-Jungner-1968.pdf
- LADR. Die familiäre Hypercholesterinämie – Genetische Diagnostik. www.ladr.de. https://www.ladr.de/fuer-aerztinnen/fachinformationen/ladr-informiert/molekulargenetische-diagnostik/familiaere-hypercholesterinaemie (accessed 17 Nov 2023).
Transkript
Nößler: Einmal im Monat die Gesundheitsuntersuchung für alle. Ergänzt vielleicht noch mit ein paar weiteren Laborparametern, und die Welt wäre doch in Ordnung. Ärztinnen und Ärzte würden sich an sogenannter Prävention satt verdienen. Und diejenigen, die irgendein pathologisches Ereignis haben oder ein Risiko dafür, die würden wir früh rausfischen. Schöne neue Welt? Oder eigentlich nur Unfug? Ein Fall für eine neue Episode vom EvidenzUpdate-Podcast. Wir, das sind ...
Scherer: Martin Scherer.
Nößler: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DEGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Denis Nößler, Chefredakteur der Ärzte Zeitung aus dem Haus Springer Medizin. Moin, Herr Scherer.
Scherer: Moin, Herr Nößler. Hallo.
Nößler: Wir wollen heute über die tollste Nebensache der Welt reden. Sie freuen sich drauf.
Scherer: Die Früherkennung von Erkrankungen natürlich.
Nößler: Ja, die tollste Nebensache der Welt ist die Früherkennung von Erkrankungen. Es geistert ja so ein bisschen die Vorstellung, gesellschaftlich kann man sagen, aber vielleicht sogar in der Medizin herum, dass Früherkennung eigentlich eine total vernünftige Sache ist. Risiken identifizieren, genau wissen, wem was droht, Leute stratifizieren, engmaschig beobachten zu können. Ist ja eigentlich per se mal eine ganz tolle Sache. Vorsorge.
Scherer: Die Grundidee ist natürlich gut, aber man sollte Früherkennung nicht mit Prävention verwechseln. Prävention im Gesundheitswesen ist dann Oberbegriff für ein ganzes Paket von Maßnahmen. Aktivitäten, die Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen vermeiden, die das Risiko für Erkrankungen verringern und so weiter. Also optimalerweise passiert Prävention vor der Praxis oder vor der Kliniktür. Hinter diesen Türen kann man dann Früherkennung betreiben. Das wird auch heute schon vielfach getan. Aber die Frage ist eben: Was ist Teil des klassischen Medizinsystems und was muss außerhalb des Medizinsystems passieren?
Nößler: Und Prävention – das habe ich jetzt rausgehört – passiert eigentlich außerhalb des Medizinsystems. Und Früherkennung hat im Medizinsystem zu passieren.
Scherer: Sowohl als auch. Aber es gibt natürlich wesentliche Anteile der Verhältnispräventionen, die dem Medizinsektor vorgelagert sein müssen. Da werden wir später wahrscheinlich noch darauf kommen.
Nößler: Verhältnisprävention, Verhaltensprävention – das werden wir gleich mal aufdröseln. Wir holen tatsächlich mal die Hörerinnen und Hörer ab mit dem Hintergrund des Gesprächs heute. Die Insider werden es wissen, es geht um die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hat ja – Stichwort Impulspapier – eine Idee vorgelegt vor einiger Zeit, dass man kardiovaskuläre Risikoprofile quasi schon bei Kindesbeinen detektieren sollte. Und parallel dazu hat er ja Pläne für das BIPAM, wir haben eine Art Präventionsinstitut, eine Weiterentwicklung der BZGA vorgelegt. Bei uns in der Ärzte Zeitung wurde das auch schon mal zum Früherkennungsinstitut. Und tatsächlich, es gibt sehr konkrete Vorstellungen von ihm in diesem Impulspapier, da ist nämlich die Rede von einem sogenannten Kaskadenscreening auf familiäre Hypercholesterinämie. Bevor wir da jetzt im Detail einsteigen und uns anschauen, was das bringen soll oder vielleicht auch nicht bringen kann, müssen wir vielleicht noch mal ein paar Jahre zurückgehen, Herr Scherer. In unserer Vorbereitung haben Sie mir eine Fundstelle unter die Nase gehalten, die schon ein paar Jahre alt ist. Es ist ein Paper von Ihnen und Michael Kochen aus dem Jahr 2006. Das packen wir wohin, Herr Scherer?
Scherer: In die Shownotes.
Nößler: In die Shownotes. Und wenn ich das richtig sehe, ging es damals um die Bildgebung des Augenhintergrunds zur Früherkennung eines Schlaganfallrisikos. Das müssen Sie uns erst mal erklären, was das für ein Paper ist.
Scherer: Das Ganze hieß Talking Eyes. Das war ein Fundus-Imaging-Verfahren, patentrechtlich geschützt zur bildgebenden Darstellung des Augenhintergrundes. Und das sollt eine nichtinvasive Abschätzung des individuellen Schlaganfallrisikos ermöglichen. Es wurde dann auch entsprechend propagiert. Es gab dann auch einen fünfstufigen Microangiopathy Score, den CORMAR-Score. Und in dessen Berechnung sollten quantitative und qualitative Netzhautbefunde eingehen. Dann vielleicht noch kardiovaskuläre Risikofaktoren, Hypertonie, Diabetes. Und dann sollte eben basierend auf diesem Fundus Imaging, auf diesem Fundusfoto das individuelle Risiko angegeben werden.
Nößler: Und die Rationale haben die damals wie erklärt, die Augenärzte?
Scherer: Die Rationale war, dass die Netzhaut als Fenster zum zerebralen Gefäßsystem dient. Das Verfahren sollte somit eben eine Abschätzung des individuellen Gefäßstatus ermöglichen, quantitativ und qualitativ. Und die Idee war natürlich, das nicht auf Individualebene zu machen, auf IGeL-Ebene, wie es das heutzutage auch gibt, sondern tatsächlich als Bevölkerungsscreening.
Nößler: Die Rationale ist ja nachvollziehbar, so wie Sie es erklären.
Scherer: Die Rationale ist grundsätzlich nachvollziehbar, dass man die Retina als Fenster zum Gefäßsystem betrachtet.
Nößler: Und jetzt kommt aber der Cliffhänger, weil Sie mit Kollege Kochen damals sich in dem Paper relativ deutlich dagegen ausgesprochen haben, das als bevölkerungsweites Screening anzubieten. Warum?
Scherer: Weil Früherkennungsprogramme nützen können, aber auch schaden können. Der Schaden tritt meistens sofort auf. Der Nutzen eines Screenings wird in der Regel erst später sichtbar. Und wir wissen aus vielfältigen Podcasts – es ist inzwischen auch Common Sense nach Covid und den vielen Testungen –, dass wir eine gute Spezifität brauchen und eine gute Sensitivität. Wenn die Sensitivität nicht stimmt, übersehen wir zu viele Fälle. Wenn die Spezifität nicht gut genug ist, verursachen wir einen großen Schaden an der zu untersuchenden Bevölkerung. (Anm.: Im Original haben wir an dieser Stelle Sensitivität und Spezifität aus Versehen vertauscht; im Transkript ist es nun korrekt. Wir bitten um Nachsicht.) Obwohl für die Gesamtpopulation vielleicht bedeutungslos, kann ein einziger falsch positiver Befund für einen einzelnen Menschen natürlich verheerende Folgen haben. Inzwischen ist es so, dass es sich auch insgesamt durchgesetzt hat, dass im besten Fall ein Screening nützt und kardiovaskuläre Todesfälle verhindert, aber im schlechtesten Fall es schadet. Und im zweitschlechtesten Fall es zwar nicht schadet, aber unnötig Geld kostet, das man anderswo besser einsetzen könnte. Also für diese Risiko-Nutzen-Abwägung lagen damals 2006 für das Fundus Imaging die Daten nicht vor. Und deshalb haben wir letztendlich gesagt, wir sehen das kritisch.
Nößler: Ich will das Thema Schaden noch mal ganz kurz abreißen. Weil Sie haben schon gesagt, schaden kann das Ding uns auf mindestens zwei Ebenen, also individuell – wir kennen das von der Prostatakrebsfrüherkennung. Wenn man das unsystematisch breit macht, dass dann im Zweifel zu viele nicht notwendige Eingriffe erfolgen mit dem Risiko Inkontinenz und Co. Was wäre denn hier der konkrete individuelle Schaden gewesen, zum Beispiel eine unnötige Gerinnungshemmung?
Scherer: Oder unnötige Folgeuntersuchungen oder eine unnötige Übertherapie der Risikofaktoren.
Nößler: Und der volkswirtschaftliche Schaden wäre das Geld, das man ausgibt, unnötigerweise.
Scherer: Ganz genau. Das Geld, das man anderweitig vielleicht effizienter verwenden könnte.
Nößler: Jetzt einmal ein bisschen bösartig gefragt: Kann man solche Versuche wie damals denen aus der Augenheilkunde so ein bisschen auch als – das ist jetzt wirklich bös gesprochen – Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder vielleicht auch als Versuch, das eigene Fachgebiet aufzuwerten, verstehen?
Scherer: Im Phänotyp sind es Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Genotypisch oder von der Intension her liegt dem natürlich ein ehrenwertes Ansehen zugrunde. Das muss man den Kolleginnen und Kollegen unterstellen. Und tatsächlich, gerade die spezialistischen Fächer, die sehen das auch als Teil der Weiterentwicklung ihres Fachs, dass sie ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Also während Zahnärzte zum Beispiel früher nur gefragt haben: Tut es weh oder wo tut es weh, sehen sie heute zum Beispiel den Mundraum als Abbild der Generalgesundheit beziehungsweise ist der mundgesundheitliche Zugang etwas, was auf den ganzen Körper hinweist. Und so ist es schon auch in vielen Spezialdisziplinen eine eigentlich positive Tendenz, über den eigenen Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen und die Schnittstellen zu den anderen Disziplinen zu sehen. Also im Grunde genommen ist es nicht zu kritisieren, dass man so ein bisschen weiterdenkt.
Nößler: Ich habe neulich gehört, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte sich jetzt für Rauchentwöhnung interessieren.
Scherer: Macht den Atem besser und die Zähne schöner.
Nößler: Definitiv. Und die sehen wahrscheinlich die Folgen relativ direkt.
Scherer: Ganz genau.
Nößler: Vielleicht kann man, Herr Scherer, aus dem, was Sie damals beschrieben haben, 2006 – das wird ja nicht auf einmal aufgepoppt sein und Michael Kochen und Martin Scherer hatten jetzt quasi die große Welterkenntnis und gesagt: Nein, das geht so niemals. Sie werden ja gewissen Prinzipien eines guten und schlechten Screenings entlang gefolgt sein bei der Bewertung dieser Vorschläge, die es damals gab. Kann man denn heute auch noch sehr exemplarisch so ein paar Kriterien definieren, wann ein Screening sinnvoll und wann es eigentlich kompletter Unfug ist?
Scherer: Das kann man, und das haben wir damals auch gemacht. Also Ausgangspunkt damals war, man fotografiert der Bevölkerung den Fundus und leitet davon Schlussfolgerungen für das kardiovaskuläre Risiko ab. Das war der Ausgangspunkt. Und folgende Kriterien haben wir damals angelehnt oder folgende Fragen haben wir gestellt, zum Beispiel: Ist durch qualitativ hochwertige randomisiert kontrollierte Studien bewiesen, dass ein solchen Screeningprgramm die Mortalität senken kann? Oder nächste Frage: Sind als Resultat des Screenings eingesetzte Maßnahmen in ihrer Wirksamkeit durch randomisiert kontrollierte Studien evaluiert? Das heißt, ist die therapeutische Konsequenz, die aus dem Screening erfolgt, durch Studien belegt? Oder: Wie hoch ist eigentlich die Number needed to screen? Also wie viele Personen müssen überhaupt untersucht werden, um ein Todesfall zu verhindern? Und wie hoch ist die Number needed to harm, wie viele Personen müssen untersucht werden, damit eine Person durch das Screening Schaden erleidet? Dann müsste man eigentlich noch die Konfidenzintervalle kennen. Man muss eigentlich auch die Kosten für das Screening kennen. Und eigentlich müsste man auch wissen, ob man dieses Geld nicht woanders besser oder wirkungsvoller einsetzen könnte. Und all diese Fragen konnten wir nicht im Sinne dieses Screenings beantworten. Und deshalb haben wir uns in diesem ZFA-Artikel negativ ausgesprochen.
Nößler: Und am Ende ist es eine IGeL-Leistung geblieben.
Scherer: Es ist eine IGeL-Leistung geblieben. Und interessant ist, dass die Studie von 2006, die Kriterien selber sind aus den 60er Jahren. Und ein bisschen traurig, fast beschämend, dass man diese Kriterien heute eigentlich immer wieder noch vortragen muss, also dass die noch nicht in das gesundheitspolitische Allgemeingut übergegangen sind.
Nößler: Wer hat die Kriterien in den 60er Jahren entwickelt? Kann man das sagen, woher das kommt?
Scherer: In den 60er Jahren waren das Wilson und Jungner im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation. Und wir können diese Referenz auch gerne noch in die Shownotes stellen.
Nößler: Das machen wir gerne. Wilson und Jungner für die WHO in den 60er Jahren. Bei den Kriterien, die Sie genannt haben – ich habe jetzt fünf, sechs Pi mal Daumen mitgezählt – fallen ganz verschiedene Ebenen auf. Also das eine, was Sie angesprochen haben, eigentlich ein Grundprinzip, ich mache keine Diagnostik, wenn daraus keine therapeutische Konsequenz folgt. Das gilt auch für ein Screening.
Scherer: Ganz genau. Also die positive Beantwortung all dieser Screeningfragen setzt natürlich voraus, dass die Screeninguntersuchung therapeutische Konsequenzen hat. Und die therapeutischen Konsequenzen wiederum, die müssen natürlich auch evidenzbasiert sein. Also Früherkennung macht nur Sinn, wenn eine anerkannte Behandlungsmethode zur Verfügung steht, die man auch zeitnah einsetzen kann. Und letztlich ist es entscheidend für die Einführung eines Screenings, dass man einen gewissen Wertzuwachs hat, also einen Add Value.
Nößler: Und der andere Punkt aus der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung ist das Thema NNS, Number needed to screen. Das hat etwas mit Populationswirksamkeit zu tun, Efficacy im weitesten Sinne.
Scherer: Ganz genau. Mit absoluter Risikoreduktion im Grunde genommen. Also wie viel Menschen muss ich screenen, um einen Todesfall zu verhindern. Und das ist ja auch Sinn und Zweck, denn meistens gelingen Programme auch. Wenn Sie an die onkologischen Screeningprogramme denken, an das Mammographie-Screening beispielsweise, auch da muss ich natürlich ganz genau die Number needed to screen kennen, aber auch die Number needed to harm. Also was passiert eigentlich, wenn ich tausend Menschen der Strahlung ausgesetzt habe.
Nößler: Genau. Wobei die Nachfrage bei Mamma-CA-Screening kippt es ja eher noch zugunsten des Screenings. Während es bei anderen Krebs-Screenings eher schwierig ist, oder?
Scherer: Das ist noch mal ein eigenes großes Thema. Aber letztlich ist es so, dass es da von den einzelnen Screeningprogrammen her deutliche Unterschiede gibt. Und selbstverständlich, wenn Sie das Mammografie-Screening mit dem Hautkrebsscreening vergleichen, sehen Sie Unterschiede – wohlgemerkt das systematische Hautkrebsscreening, das hatten wir ja auch mal als Thema, nicht das opportunistische Screening. Dagegen ist natürlich nichts einzuwenden.
Nößler: Jetzt wollen wir uns tatsächlich die FH anschauen oder zumindest das angedachte Screening auf eine familiäre Hypercholesterinämie. Und nach den Gedanken in diesem Impulspapier soll das bei Fünfjährigen, ich glaube bei der U6, zunächst einmal überlegt werden. Das sind zumindest so die ersten Gedanken. Herr Scherer, über wie viel Menschen reden wir eigentlich, was das Thema Familiäre Hypercholesterinämie angeht in Deutschland?
Scherer: Da gibt es unterschiedliche Zahlen zu. Es gibt einen älteren Artikel aus dem deutschen Ärzteblatt, da geht man von 1 zu 500 aus, bei dieser doch häufigsten genetischen Störung. Es gibt dann zwei neuere Metaanalysen, die zu dem Ergebnis kommen, dass die weltweite – wohlgemerkt – Prävalenz der familiären Hypercholesterinämie bei rund 1 zu 300 liegt. Natürlich bei arteriosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Rate dann noch etwas höher. Also über wie viele Menschen reden wir hier? Ich würde mal sagen, über 300.000 Menschen.
Nößler: Und das wäre mit Blick auf die Geburten rund 1.000 bis 1.800, irgendwas dazwischen.
Scherer: Ja.
Nößler: Jetzt brauchen wir vielleicht gar nicht so tief einsteigen in doppelte Häufigkeitsbäume oder so. Aber wir wissen, dass die Gesamtheit an Ereignissen pro Population am Ende die Vortestwahrscheinlichkeit ganz entscheidend bestimmt.
Scherer: Das ist so. Da hatten wir gefühlt schon sieben Podcast zu. Also wenn die Vortestwahrscheinlichkeit schon sehr stark auf einer Seite liegt, also die gesuchte Erkrankung sehr wahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich ist, dann trägt eine weitere Untersuchung nur wenig zur Diagnosestellung, also zur Nachtestwahrscheinlichkeit bei.
Nößler: Vielleicht auch das noch mal vorweggeschickt, Herr Scherer: Wir wollen in diesem Podcast weder Disease Mongering machen, noch wollen wir Krankheitsleiden, Krankheitslast irgendwie relativieren.
Scherer: Auf keinen Fall.
Nößler: Wir wollen sie grundsätzlich ernst nehmen und mit den Methoden der Wissenschaft und dem, was man weiß, verstehen. Wenn eine familiäre Hypercholesterinämie vorliegt, so richtig spaßig ist es nicht. Das muss man an der Stelle auch mal sagen.
Scherer: Das ist alles andere als spaßig. Bei der heterozygoten Form kann man da sehr Serumcholesterinämie-Werte von 290 bis 550 mg/dl erwarten, bei homozygoten Merkmalsträgern kann das bis 1.000 mg/dl hochgehen. Und dann finden Sie schon auch Sehnenxanthome vor allem am Handrücken, an der Achillessehne, Sie können Xanthelasmen sehen oder diesen Arcus Lipoides Corneae. Und natürlich ist das Risiko einer vorzeitigen KHK deutlich höher. Unbehandelte Männer haben ein 50-prozentiges Risiko, vor dem 60. Lebensjahr einen Myokardinfarkt zu bekommen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ein 50-prozentiges Risiko. Und bei Frauen ist es sieben bis zehn Jahre später. Also es ist schon eine relevante Erkrankung, über die wir hier sprechen.
Nößler: Und das vorweggeschickt. Da könnte man natürlich wirklich zu der Überlegung kommen, okay, dann ist es doch klug, diese Person auch, bevor sie phänotypisch, haben Sie eben gesagt, bevor sie auffallen, bevor die Klinik ganz offensichtlich ist, frühzeitig zu erkennen und dann vielleicht auch engmaschig zu betreuen und da gegebenenfalls auch mit den Therapien reinzugehen. Das wäre ja eigentlich eine kluge Sache.
Scherer: Absolut. Also für die Betroffenen ist eine Früherkennung von entscheidender Bedeutung.
Nößler: Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Sie haben das eben gesagt: Okay, keine Diagnostik ohne therapeutische Konsequenz. Nützt denn da abschließend zum Beispiel die Statingabe etwas bei denjenigen, schon in frühen Jahren?
Scherer: Also zumindest liegt eine Kohortenstudie vor, die das nahelegt. Also es gibt eine Kohortenstudie von Luirink et al., relativ rezent, aus dem England Journal of Medicine und bei früher Statingabe bei den Kindern mit familiärer Hypercholesterinämie die Progression der Intima-Media-Dicke verlangsamt werden konnte.
Nößler: Gut. Das ist aber noch nicht der härteste Endpunkt, den man sich wünschen kann, nämlich die Zahl der kardiovaskulären Ereignisse, im Zweifel Tod.
Scherer: Erstens das. Und zweitens ist es auch so, dass eine solche Studie nicht geeignet ist, um die Sicherheit und Effektivität einer Statinbehandlung von Kindern zu belegen. Es ist eine Beobachtungsstudie erst mal, es ist keine Interventionsstudie. Zwar wurden Geschwister und Eltern als Vergleichsgruppen hinzugezogen, aber es bleiben natürlich die ganzen Screeningfragen unbeantwortet, die einer solchen Intervention vorangestellt sein müssten. Und außerdem bezieht sich das Paper genau auf die Patienten, die wir auch heute schon erfassen, nämlich Eingangsalter von 13 Jahren, das ist die J1. Aber es geht hier nicht um ein vorausgegangenes flächendeckendes Cholesterin-Screening, wie jetzt vorgeschlagen bei Fünfjährigen. Das heißt, es ist schon eine wichtige Arbeit, die zu beachten ist. Es ist eine große Kohortenstudie, aber auch mit einem langen Beobachtungszeitraum. Aber man sollte sie hinsichtlich der Schlussfolgerungen nicht überlasten.
Nößler: Das heißt, die Studienpopulation in dieser Beobachtungsstudie, die war deutlich älter als das, was jetzt vorgesehen ist, mit den Fünfjährigen. Und wenn ich Sie richtig verstehe, retrospektiv, nicht prospektiv angelegt. Und so Geschichten wie, ich sage mal jetzt Verträglichkeit, Myalgien, Fragezeichen – das kann man dann im Zweifel gar nicht wirklich ablesen.
Scherer: Und außerdem ist bei so Langzeitstudien natürlich auch ein Nachteil, dass die unterschiedliche Behandlungsspektren dann da drin haben, je nachdem, was zu einem bestimmten Zeitpunkt en vogue oder als Standardtherapie angesagt war.
Nößler: Es wird also nicht für die gesamte Interventionsgruppe dasselbe Protokoll verfolgt.
Scherer: Korrekt.
Nößler: Das heißt, diese Arbeit, die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, die gibt uns höchstens Indizien, wo man weitersuchen müsste. Aber mehr nicht.
Scherer: Und die gibt einen guten Anhaltspunkt dafür, dass Kinder mit der familiären Hypercholesterinämie von einer frühen Statinbehandlung profitieren können. Aber sie können darauf noch keine systemverändernde Intervention aufbauen.
Nößler: Dann stellt sich natürlich die Frage – ich meine familiäre Hypercholesterinämie ist jetzt kein Krankheitsbild, das gestern vom Himmel gefallen ist. Das kennt man länger. Es gibt ja durchaus auch bei den Leuten, die wirklich ganz schlimm davon betroffen sind, mittlerweile auch Ansätze, was man da machen kann. Gibt es denn wenigstens irgendeinen Ansatz in der Literatur? Gibt es irgendetwas, das ein Frühscreening einen gewissen Nutzen bringen könnte? Gibt es irgendetwas in der Literatur? Ich meine, wir denken immer an Cochrane & Co.
Scherer: Also man muss wahrscheinlich hier auch zwischen Kaskaden- und einem systematischen Screening unterscheiden. Wir kommen zum Kaskadenscreening später noch. Aber wenn man jetzt mal die gängigen Wellen sich anschaut, zum Beispiel die USPSTF, das ist die U.S. Preventive Services Task Force von 2023, also sehr frisch, dann kommt die USPSTF zu dem Schluss, dass die derzeitige Beleglage unzureichend ist und das Nutzen-Schaden-Verhältnis für ein Screening auf Fettstoffwechselstörung bei asymptomatischen Kindern und Jugendlichen bis 20 Jahre nicht bestimmt werden kann. Es gibt dann noch ein Cochrane-Review von 2021, der auch auf die familiäre Hypercholesterinämie zielt. Die haben keine vernünftigen RCTs oder kontrollierte nicht randomisierte Interventionsstudien gefunden, die geeignet wären, Vorteile einer systematischen Identifizierung von Individuen mit familiärer Hypercholesterinämie zu belegen. Es wurden ein paar unkontrollierte Vorher/Nachher-Studien gefunden, die jedoch nicht in den Review mit aufgenommen wurden. Und weitere Studien zur Bewertung von Gesundheitsversorgungsstrategien sind eigentlich noch ausstehend, um da die Beleglage etwas zu erhärten. Es gibt da noch einen etwas älteren Cochrane-Review von 2016. Da geht es mehr so um das Screening auf Herz-Kreislauf-Erkrankung insgesamt. Auch da keine durchgreifenden Effekte. Und dann noch eine BMJ-Einzelstudie. Ich glaube, die ist von 2016, Effect of screening and lifestyle counselling on incidence of ischaemic heart disease in general population: Inter99 randomised controlled trial. Also ein Community-basierter Ansatz, individuell zugeschnittenes Interventionsprogramm mit Screening auf das Risiko einer ischämischen Herzerkrankung. Und auch hier über fünf Jahre konnte man da keine Auswirkungen auf KHK-, Schlaganfälle-Sterblichkeit auf Bevölkerungsebene sehen. Also lange Rede kurzer Sinn. Die Beleglage, die spricht eigentlich eindeutig a) gegen ein kardiovaskuläres, systematisches Screening, aber insbesondere auch gegen ein Screening auf familiäre Hypercholesterinämie. Tut mir leid, wenn das ein bisschen lang war jetzt.
Nößler: Gut, das ist ja der Versuch, einerseits die rezente Literatur und vielleicht auch die aus den letzten Jahren etwas auffälligere Literatur etwas zu umreißen. Es geht alles in die Shownotes, Sie haben es gesagt. Aber jetzt kann natürlich die typische Antwort sein, auf die immer gleichlautende, gebetsmühlartige EBM-Kritik, es gibt keine belastbaren Aussagen, also können wir nicht sagen, dass es gut ist. Und wenn wir nicht sagen können, dass es nicht gut ist, müssen wir im Zweifel davon ausgehen, dass es schlecht ist. Das ist ja so die Abfolge. Und die typische Antwort darauf könnte ja lauten: Nur weil wir nicht beweisen können, dass es nicht gut ist, heißt es nicht, dass es nicht vielleicht doch gut ist.
Scherer: Ja. Allerdings beruhen diese Ansätze ganz auf medizinnahe Verhaltensprävention anstatt auf bürgernahe Verhältnisprävention. Es gibt genügend Literatur, die zeigt, dass Präventionsprogramme, die das Verhalten der Individuen ändern wollen, also der Bürgerinnen und Bürger, dass die wenig wirksam sind. Und dass die einen starken sozialen Gradienten aufweisen. Das heißt, diejenigen, die an individuellen Präventionsmaßnahmen teilnehmen, brauchen diese meist am allerwenigsten. Und deshalb wäre es besser, die Ressourcen in die Verbesserung der Lebensbedingungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen zu investieren, um eben den Graben zwischen privilegierten und weniger privilegierten Menschen zu verringern. Das heißt also, Herr Nößler, dass die Gesundheit nicht allein von dem individuellen Verhalten und der Gesundheitsversorgung bestimmt wird. Da gibt es noch viele andere Faktoren. Und es wäre wirklich ein Fehler, zu sehr auf die Medizin zu schielen und alles das, was der Klinik- und Praxistür vorgelagert ist, außer Acht zu lassen.
Nößler: Das, was Sie jetzt ansprechen, das sind die sogenannten lebensstilbedingten Faktoren, die man, wenn ich Sie richtig verstehe, besser nicht im Lebensstil ausschließlich verändern sollte, sondern in den Bedingungen für den Lebensstil. Also das wäre dann die Verhältnisprävention. Jetzt würde ich natürlich als Minister Lauterbach Ihnen entgegnen, Herr Scherer: Moment mal, bei der familiären Hypercholesterinämie habe ich eine genetische Disposition. Die kann ich ja nicht durch Verhältnisprävention beeinflussen.
Scherer: Da haben Sie recht. Diese Menschen brauchen eine definierte Therapie, die brauchen frühzeitig Statine. Das stimmt. Allerdings habe ich Ihre Frage beantwortet, die da lautete: Warum gibt es denn eigentlich so wenig Evidenz für Früherkennungsprogramme? Und das war meine Antwort, dass das eben ein bisschen komplexer ist und dass die Möglichkeiten der Medizin begrenzt sind.
Nößler: Das heißt, noch mal global gesprochen, jenseits der FH ist es vielleicht eine Fehlannahme, die in diesem Screeningprogramm drinstecken kann, dass wir screenen wollen, in der Hoffnung, eine Monokausalität oder vielleicht auch im besten Fall eine Bikausalität oder zumindest abschließbar erkennbare Kausalitäten zu identifizieren. Und wenn ich die dann tatsächlich wegtriggere, dann ist alles fein. Und dabei fällt mal ganz gelinde unter den Tisch, dass das nicht nur humane Leben sehr viel komplexer ist und beispielsweise eben auch von der Umwelt getriggert wird.
Scherer: Genauso ist es. Wer Prävention meint, aber immer nur nach Früherkennung ruft, der unterliegt eigentlich überhöhten Vorstellungen an das, was die Medizin zu leisten vermag. Also Gesundheit ist nur zu einem begrenzten Anteil ein Ergebnis der Gesundheitsversorgung. Zum überwiegenden Teil ist Gesundheit geprägt vom Alltag der Menschen. Und das sind genau die Fragen, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Nößler, wie wohnen die Menschen, wie arbeiten die Menschen, wie lernen sie, wie leben sie. Und deshalb gibt es international ein „Health in All Policies“-Ansatz, also kurz HIAP, auch von der WHO empfohlen. Und Ziel ist es vor allem, die soziale Ungleichheit zu verringern, um mehr Gesundheit für alle zu erreichen.
Nößler: Ich glaube sogar, diese Ampel-Koalition hatte sich das zumindest andeutungsweise im Koalitionsvertrag reingeschrieben. Aber bedeutet zum Beispiel Städteplanung, Verkehrswegeplanung et cetera. Auch das von Ihnen immer mal wieder benutzte Beispiel mit der Zuckersteuer wäre so etwas.
Scherer: Ganz genau. Und natürlich auch Alkohol, Nikotin.
Nößler: Noch mal zurück zu dem Thema Familiäre Hypercholesterinämie. Sie haben jetzt tatsächlich zwei Arbeiten auch zitiert. Also USPSTF und diese eine Cochrane-Arbeit, die sich speziell mit dem Thema Lipid-Screening beschäftigt haben. Und die haben jetzt erst mal keine belastbare Evidenz pro Nutzen gefunden, auf Basis vernünftig durchgeführter hochqualitativer Studien. Es stellt sich natürlich jetzt ganz intuitiv die Frage: Warum findet man da keinen Effekt? Also ganz banal pathologisch gedacht: Arteriosklerose ist gleich schlecht, ist gleich Infarkt, ist gleich Insult – da würde man doch erwarten, dass man da einen Nutzen findet.
Scherer: Ich glaube, wenn Sie die Menschen identifizieren würden in einem RCT und dann einer Kontrollgruppe gegenüberstellen, die einen behandeln, die anderen nicht, dann finden Sie ganz klar einen Nutzen. Aber in einem bevölkerungsbezogenen Screening, über das wir hier sprechen, gehen die Effekte einfach unter.
Nößler: Sie haben initial in dem Gespräch von dem Begriff Kaskadenscreening gesprochen, über den wir noch reden müssten. Dieser Begriff kommt in diesem Impulspapier vor. Und auf der anderen Seite haben Sie von dem opportunistischen Screening gesprochen, wo man halt, wenn es einen klinisch sinnvollen Anlass gibt, nachschaut. Vielleicht müssen wir an der Stelle diesen Unterschied erklären, wie ein Screening eigentlich sinnvoll sein kann.
Scherer: Sie müssen im Grunde genommen drei unterschiedliche Arten des Screenings unterscheiden. Sie kommen gut gebräunt aus dem Herbsturlaub zurück und nehmen das zum Anlass, sich mal die Haut angucken zu lassen. Das wäre ein opportunistisches Screening. Das andere, was Sie machen können – wir haben schon oft darüber gesprochen – wäre ein systematisches bevölkerungsbezogenes Screening, zum Beispiel beim Hautkrebsscreening oder bei anderen Dingen, wo Sie wirklich den Bevölkerungsansatz wählen. Und das Dritte ist das Kaskadenscreening. Also wenn eine Indexperson früh im Leben eine kardiovaskuläre Erkrankung erfährt, werden andere Familienmitglieder gescreent. Das wäre das Kaskadenscreening. Und das gibt es tatsächlich auch in einigen Ländern.
Nößler: Das würde quasi bedeuten, dass man sich – kann man jetzt pars pro toto diese Erkrankung nehmen – beispielsweise auch über einen Score, über gewisse Stufen vorantastet und sagt, wenn ich positive Familienanamnese habe dafür, dann mache ich den nächsten Schritt. Und dann gucke ich mir zum Beispiel mal das LDL an.
Scherer: Genau. Das wäre eine Alternative dazu. 738.000 Kindern Blut abzunehmen und dafür ungefähr eine Milliarde Euro auszugeben.
Nößler: Das wäre dann die Genanalyse.
Scherer: Genau. Also beim Kaskadenscreening wird bei Patientinnen und Patienten mit diagnostizierter familiärer Hypercholesterinämie gezielt nach Familienmitgliedern gesucht, die dann auf die entsprechende genetische Variante getestet werden.
Nößler: Also da hat man dann tatsächlich die positive Anamnese und dann schaut man da einfach weiter. Und denen bietet man das an. Und das wäre auch eine gescheite Sache, weil man da die Vortestwahrscheinlichkeit erhöht.
Scherer: Ganz genau. Und man kommt nicht in die Situation, systemisch screenen zu müssen, mit einem Bluttest, 738.000 Kindern jedes Jahr Blut abnehmen zu müssen. Und dafür dann eine Milliarde Euro zu bezahlen.
Nößler: Wenn ich das richtig rausgehört habe, haben Sie auch den Zeitpunkt indirekt infrage gestellt. Es ist ja im Moment in diesem Papier die U6 vorgesehen, im Alter von fünf Jahren. Und Sie haben mit Blick auf die Arbeit aus dem England Journal, glaube ich, die Sie eben angesprochen haben, gesagt, das ist eine Population, die ist eigentlich schon älter. Wie könnte man es denn in den U- beziehungsweise J-Untersuchungen klüger anlegen? Wir können ja hier mal so ein bisschen Politikberatung machen.
Scherer: Im Grunde genommen haben Sie es ja schon so ein bisschen insinuiert. Dadurch dass Sie den Kaskadenbegriff eingeführt haben. Eine Möglichkeit ist ja, dass man sich durch Anamnesefragen an Risikokonstellationen herantastet. Das könnte in der J2 der Fall sein. J2 ist das richtige Alter. Also Prävention und Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter haben einen sehr hohen Nutzen. Und da können Sie auch relativ früh strukturell arbeiten, auch an sozioökonomischer Benachteiligung und ungleichen Gesundheitschancen in diesen Lebensläufen. Aber ich denke dann auch immer gleich an die Verhältnisprävention. Und dieser Verhältnisprävention muss man interdisziplinär und interprofessionell eine hohe Priorität einräumen. So sähe für mich eine optimale J2 aus.
Nößler: Was Sie im Moment nicht gesagt haben, aber eigentlich doch gesagt haben, ist, mit so einem Programm könnten wir fehlgeleitet einen Haufen Geld rausschmeißen, was wir klüger einsetzen könnten.
Scherer: Ja, Sie sind einfach ein Meister im Schließen hermeneutischer Kreise. Wir haben ja ganz am Anfang dieses alte Fundus-Imaging-Papier ausgegraben, wo eine der letzten Fragen für die Einführung von Screenings war, kann ich mit dem Geld nicht was anderes machen, was eine höhere Effektstärke hat. Und das wäre jetzt die entscheidende Frage, wenn wir mal wirklich davon ausgehen, dass ein solches Screening eine Milliarde – das ist wirklich nur ein geschätzter Betrag, den müssen wir noch ein bisschen unterringeln und vielleicht auch noch in den Faktencheck geben – aber wenn wir wirklich für so ein Screening auf familiäre Hypercholesterinämie bei Kindern jährlich eine Milliarde Euro ausgeben, stellt sich wirklich die Frage: Gibt es nicht etwas, womit wir eine höhere Effektstärke erzielen können, wenn wir dieses Geld investieren ... – wohlgemerkt, es soll hier jetzt nicht in eine Generationendebatte oder in das Ausspielen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen hineingehen, also nehmt die Milliarde den Kindern weg und packt sie woanders hin, das ist hier bitte so nicht zu verstehen. Sondern gibt es nicht Programme, für die die Evidenz einfach vorliegt, für die der Nutzen erwiesen ist, wo sozusagen auch der Effekt nachgewiesen ist. Denn all diese Screeningfragen, die wir beim Fundus Imaging abgearbeitet haben, die sind für das Screening von Kindern auf familiäre Hypercholesterinämie nicht beantwortet. Es gibt keine hochwertige qualitative randomisierte kontrollierte Studie, die bewiesen hat, dass die Mortalität durch ein solches Screeningprogramm – wohlgemerkt Screeningprogramm – gesenkt werden kann. Es gibt keine guten RCTs, die das Resultat des Screenings unter die Lupe nehmen, im Sinne der therapeutischen Konsequenz. Wir kennen die Number needed to screen nicht, die Number needed to harm kennen wir nicht. Wir kennen das Konfidenzintervall des geschätzten Effekts nicht. Und die Kosten, die scheinen mir doch sehr, sehr hoch zu sein. Und die Frage, welchen gesundheitlichen Nutzen könnte man erreichen, wenn die Mittel stattdessen für andere Gesundheitsbereiche verwendet wird.
Nößler: Gibt es denn andere Programme auch jenseits der Screenings, die mit guter Qualität bewiesen haben, dass sie einen positiven Effekt haben?
Scherer: Damit haben Sie mich jetzt natürlich erwischt, mit der Keule, die eigentlich auf jeden EBMler einprasselt. Wenn man das eine Programm kaputtgemacht hat, im Sinne der evidenzbasierten Medizin kritisiert hat, dann soll man doch mal bitte sagen, wo man ansonsten investieren soll beziehungsweise seine Präventionshoffnungen hinlegen sollte. Ich würde einfach mal sagen, Herr Nößler, wir machen da einen Cliffhänger draus und befassen uns mit dieser Frage das nächste Mal.
Nößler: Eine Episode in zwei Teilen. Herr Scherer, machen wir. Vielen Dank.
Scherer: Ich danke Ihnen.
Nößler: Und bis zum nächsten Mal. Ahoi und tschüss.
Scherer: Tschüss.