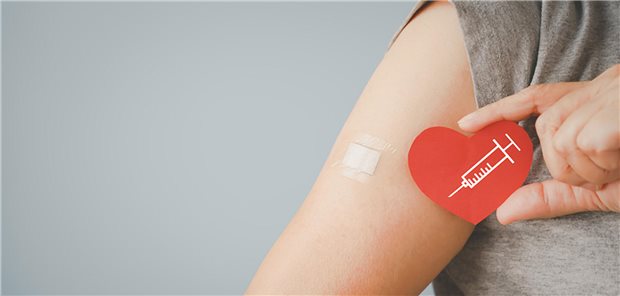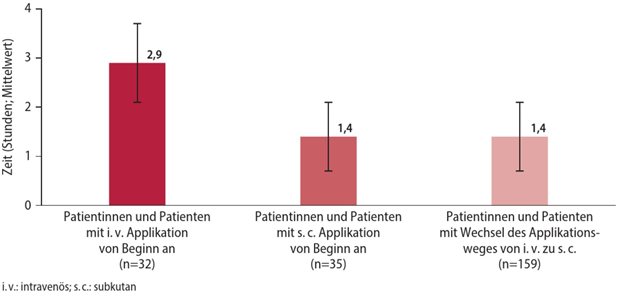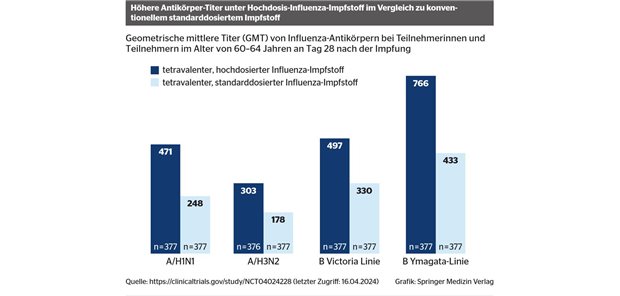Arzneimittelsicherheit
Brandenburg verzeichnet 233 Impfnebenwirkungen in zehn Jahren
Über 200 Meldungen möglicher Impfnebenwirkungen hat Brandenburg seit 2012 erfasst. Der größte Teil davon geht aber auf die Zeit während der Corona-Impfungen zurück.
Veröffentlicht:
Erwünschte „Nebenwirkung“ einer Impfung: Pflaster auf der Einstichstelle.
© Jens Kalaene / dpa
Potsdam. Brandenburgs Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) sind in den letzten zehn Jahren insgesamt 233 Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen nach einer Impfung übermittelt worden. Das geht aus einer Antwort des Potsdamer Gesundheitsministeriums auf eine „Kleine Anfrage“ der Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, Christine Wernicke, hervor, die in dieser Woche vom Potsdamer Landtag veröffentlicht wurde.
Von den erfassten Meldungen sind alleine 93 aus dem Jahr 2021 und 70 aus dem Jahr 2022, als in Brandenburg mehrere Millionen Corona-Schutzimpfungen verabreicht wurden. Die übrigen 70 Impfnebenwirkungen stammen aus den Jahren vor 2021, als sich die Brandenburger weitaus seltener etwa gegen Tetanus, Mumps, Masern oder Röteln impfen ließen.
Brandenburg zählt rund 2,5 Millionen Einwohner. Allein während der Corona-Impfkampagne ab Jahresbeginn 2021 haben dort rund 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger mindestens eine Impfdosis gegen COVID-19 erhalten, 1,4 Millionen mindestens eine Auffrischimpfung.
Wernicke: Doppelmeldungen nicht ausgeschlossen
Wie die Fragestellerin Wernicke bemerkte, sei zudem unklar, ob es in den Jahren 2021 und 2022 auch Mehrfachmeldungen gab, bei denen eine Impfnebenwirkung doppelt an das bundesweit zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und das Landesamt LAVG gemeldet wurde. „Wie viele betroffene Personen Nebenwirkungen direkt an den Impfstoff-Hersteller oder das PEI gemeldet haben, wusste die Landesregierung nicht“, sagte Wernicke.
„Auch ist ihr nicht klar, ob die Meldung bei mehreren Stellen zur Mehrfachzählung von Fällen geführt haben.“ Denn unabhängig von der Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) durch Ärztinnen und Ärzte an die Gesundheitsämter konnten Betroffene Verdachtsmeldungen auch anonym, ohne Angaben von persönlichen Kontaktdaten, direkt an das PEI übermitteln. (lass)