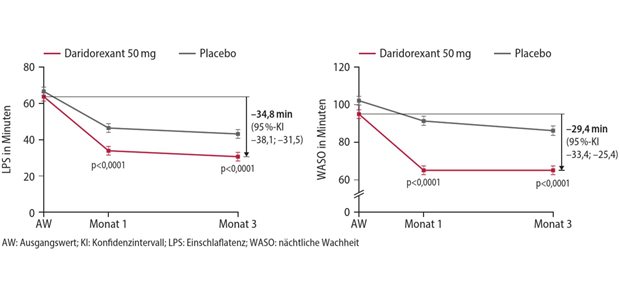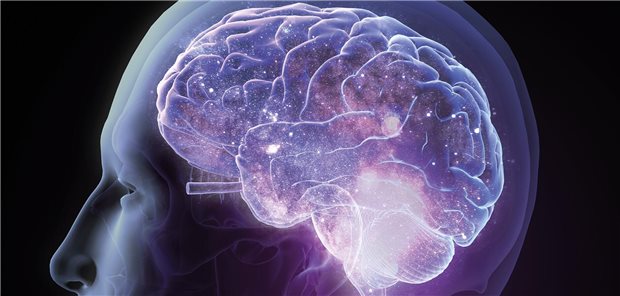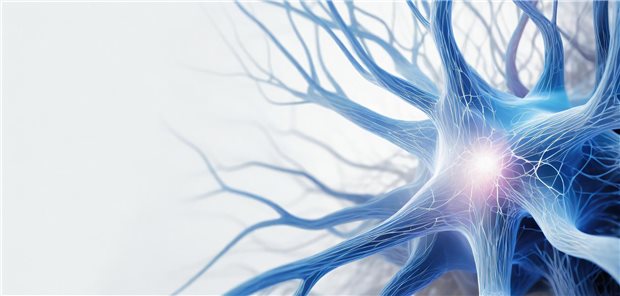Stellungnahme
DGPPN: Kein Zentralregister für Menschen mit psychischen Erkrankungen!
Nach dem Attentat von Magdeburg wurde gefordert, Menschen mit psychischen Störungen zentral zu erfassen. Die DGPPN hält das für kontraproduktiv.
Veröffentlicht:
Nach dem Anschlag von Magdeburg wurden Rufe nach einem Zentralregister für Menschen mit psychischen Erkrankungen laut.
© Peter Gercke | picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild |
Berlin. Ein Zentralregister für Menschen mit psychischen Erkrankungen, lehnt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) strikt ab.
Nach dem Attentat von Magdeburg waren Forderungen nach einem solchen Register laut geworden. Eine derartige zentrale Erfassung von Menschen mit psychischen Erkrankungen wäre nicht zielführend, sondern stigmatisierend, kritisiert die DGPPN.
Psychisch kranke Menschen seien als Gesamtgruppe nicht gewalttätiger als Menschen ohne psychische Erkrankungen und auch unter terroristischen Gewalttätern fänden sich nicht mehr psychisch Kranke als in der Gesamtbevölkerung, so die Fachgesellschaft in einer Stellungnahme.
„Psychische Erkrankungen sind generell nicht mit einem erhöhten Gewaltrisiko verknüpft“, sagt DGPPN-Präsidentin Professorin Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank.
Nur bestimmte Krankheitsbilder wie psychotische Erkrankungen oder Suchterkrankungen gingen mit einem erhöhten Risiko für Gewalttaten einher – und das auch nur unter bestimmten Bedingungen und wenn die Betroffenen nicht behandelt würden. Eine zentrale Erfassung aller Menschen mit einer psychischen Diagnose würde Gewalttaten nicht verhindern, so Gouzoulis-Mayfrank.
Ein Register würde der Stigmatisierung Vorschub leisten
Psychische Erkrankungen seien weit verbreitet, etwa ein Drittel der Bevölkerung leide jedes Jahr unter einer solchen Störung. Diese Gruppe sei als Ganzes nicht gefährlicher als Menschen ohne psychischen Erkrankungen.
Die Erfassung dieser Personen sei im Sinne der Gewaltprävention daher nicht sinnvoll. Eine zentrale Register-Erfassung würde allerdings die Stigmatisierung psychisch kranker Menschen verstärken und die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung senken.
„Menschen mit psychischen Störungen leiden nicht nur unter ihrer Erkrankung, sondern zusätzlich unter Vorurteilen und Benachteiligungen in ihrem Umfeld. Je mehr Stigmatisierung sie erleben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Betroffene in Behandlung begeben“, sagt Gouzoulis-Mayfrank.
Zudem steige die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich von einer bereits begonnenen Therapie zurückzögen. Verzögerte Behandlungen oder gar deren vollständige Ablehnung führten meist zu einer Verschlimmerung oder Chronifizierung der Erkrankung, so die DGPPN-Präsidentin. (chb)