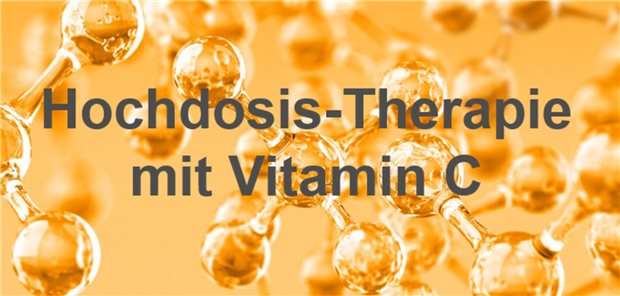Lehren aus Corona-Pandemie
Deutsche Hochschulmedizin verlangt „aktive Krankenhausplanung“
Die Hochschulmedizin verweist auf ihre zentrale Rolle in der Versorgung von COVID-19-Patienten. Daraus leitet sie Forderungen ab – auch für eine neue Krankenhausplanung.
Veröffentlicht:
Ein Schild des Uniklinikums Marburg: Die deutsche Hochschulmedizin besteht aus 39 Medizinischen Fakultäten und 35 Universitätskliniken.
© Uwe Zucchi / dpa / picture alliance
Berlin. Universitätskliniken und Medizinfakultäten haben ihre Erwartungen an die nächste Bundesregierung formuliert. Sie stützen sich dabei unter anderem auf die Erfahrungen bei der Versorgung von COVID-19-Patienten und leiten daraus Forderungen ab – finanzieller und struktureller Art.
In der Corona-Pandemie hätten sich die Universitätskliniken und Maximalversorger als Koordinatoren der regionalen Versorgung von COVID-19-Erkrankten als „bestens geeignet“ erwiesen. Diese ad hoc festgelegten Zuständigkeitsverteilungen müssten nach der Pandemie in eine neue Struktur gegossen und gesetzlich verankert werden, heißt es in dem Papier. Nötig seien dafür eine Neuausrichtung der Versorgungsplanung und ein darauf abgestimmtes Vergütungssystem.
„Aktive Krankenhausplanung“ gefordert
Gefragt sei somit eine „aktive Krankenhausplanung“, die dem Grundsatz folge: „Erst Planung, dann Finanzierung“. Gefragt sei dabei insbesondere der Bund: Da die meisten Bundesländer die Investitionskostenfinanzierung nicht allein stemmen könnten, müsse der Bund seine Förderung verstetigen.
Weitere Forderungen der Deutschen Hochschulmedizin, dem Zusammenschluss von Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten: (fst)
Das System der Fallpauschalen müsse um einen Finanzierungsansatz ergänzt werden, da Unikliniken im DRG-System unzureichend berücksichtigt sind. Dies gelte beispielsweise bei der Notfallversorgung und bei medizinischen Zentren.
Die ambulante Krankenhausversorgung dürfe nicht mit der vertragsärztlichen Versorgung gleichgesetzt werden, sondern müsse auf einem für Kliniken wirtschaftlich tragbaren Finanzierungsmodell beruhen. Mit Blick auf die ambulante Notfallversorgung in Integrierten Notfallzentren (INZ) macht die Hochschulmedizin klar, dass diese unter Federführung der Kliniken stehen müssten – unter anderem an diesem Streit ist der jüngste Versuch der Koalition gescheitert, die Notfallversorgung noch vor der Wahl zu reformieren.
Das im April 2020 gegründete Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) soll die translationale Forschung bündeln. Diese horizontale Vernetzung der Standorte im NUM sei bislang nur bis zum Jahr 2024 finanziert – nötig sei aber eine dauerhafte Perspektive. Gleiches gelte für die Medizininformatik-Initiative (MII). Hier stellt der Bund bis 2022 rund 180 Millionen Euro zur Verfügung – eine weitergehende Finanzierungsperspektive fehle bisher.
Ambulantisierung und eine neue Krankenhausplanung machten eine neue Aufgabenteilung zwischen den Professionen nötig. Diese Zusammenarbeit in interprofessionellen Teams dürfe nicht durch „veraltete Berufsauffassungen“ behindert werden. Hinsichtlich der neuen kompetenzorientierten Ausrichtung des Medizinstudiums macht die Hochschulmedizin von Mehrkosten von 400 bis 500 Millionen Euro geltend. Hieran müsse sich der Bund „als Initiator und Verordnungsherausgeber der Reform beteiligen“. Kliniken, die sich in der Weiterbildung engagieren, sollten dafür einen gesonderten „Weiterbildungszuschlag“ erhalten.
Die Hochschulmedizin macht sich für das vom Sachverständigenrat vorgeschlagene Opt-out-Modell bei der elektronischen Gesundheitsakte stark: Jeder Bürger erhält ab Geburt demnach eine ePA, die automatisch in der Versorgung eingesetzt wird – es sei denn, der Patient wünscht die Deaktivierung der ePA. Die Aufwendungen für die Digitalisierung der Patientenversorgung würden im DRG-System nicht gegenfinanziert. Nötig sei daher eine gesonderte Finanzierung der Digitalisierungskosten. Gesundheitsdaten sollten für Forschungszwecke nur pseudonymisiert werden, nicht aber anonymisiert. In letzterem Fall könnten keine Rückschlüsse aus der Forschung für die individuelle Versorgung gezogen werden. Der Nutzen für die Wissenschaft werde insoweit durch die Anonymisierung der Daten „massiv eingeschränkt“.