KV zu Integrierten Notfallzentren
Diese fünf Punkte sind für den INZ-Erfolg maßgeblich
Wie sollten Integrierte Notfallzentren gestaltet werden? Bei diesen und anderen Fragen kann die KV Rheinland-Pfalz Informationen liefern, denn sie hat bereits Erfahrungen mit einem Modellprojekt gesammelt.
Veröffentlicht: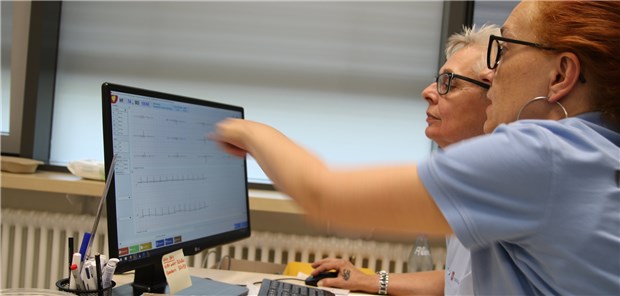
Britta Walter (rechts) und Alexandra Pietsch, beide MFA in der APC, begutachten das EKG eines Patienten.
© Anke Thomas
Mainz. Zur Entlastung der konservativen Notaufnahme der Unimedizin Mainz eröffnete die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) auf Bitten der Unimedizin im März 2019 die Allgemeinmedizinische Praxis am Campus (APC). Nach knapp einem Jahr Erfahrung mit der APC möchte die KV gerne eine Vorreiterrolle bei der Gründung von Integrierten Notfallzentren (INZ) einnehmen.
Gegenüber der „Ärzte Zeitung“ erklärt die KV RLP, welche Erkenntnisse sie mit der APC als Eigeneinrichtung gewonnen hat und was sie im Hinblick auf die Reform der Notfallversorgung in Deutschland empfiehlt.
Fünf Punkte sind laut KV RLP demnach für den Erfolg einer solchen Einrichtung maßgeblich:
- Die computergestützte Ersteinschätzung,
- sinnvolle Öffnungszeiten,
- die richtige Standortwahl,
- eine solide Finanzierung sowie
- organisatorische Voraussetzungen in den Kliniken und der KV als Betreiberin.
Rund 350 Patienten pro Monat
Das Patientenaufkommen in der APC ist bislang deutlich geringer als erwartet, so ein erstes Fazit der KV RLP. Während die Unimedizin von 1000 Patienten pro Monat ausging, die von der APC zur Ersteinschätzung hätten vorstellig werden können, sind es tatsächlich im Schnitt rund 350 Patienten pro Monat. Pro Tag werden 10 bis 17 Patienten in der APC behandelt.
Der am stärksten frequentierte Wochentag ist der Samstag. Rund zwei Drittel der Patienten, die in der APC vorstellig wurden, wurden auch abschließend dort behandelt. Knapp ein Drittel musste an die konservative oder an andere Notaufnahmen der Unimedizin weitergeleitet werden.
In der APC ist der Zeitaufwand höher
Der Zeitaufwand für die Behandlung, so die KV RLP, sei drei Mal höher als in einer normalen hausärztlichen Praxis. Das begründet die KV damit, dass bei neuen Patienten mehr Aufwand für die Erfassung der Krankheitsvorgeschichte benötigt würde.Auch dauerten Gespräch oft länger, da viele APC keinen Hausarzt und mitunter eine geringe Gesundheitskompetenz hätten. Und die Patienten würden sich oft nicht so gut im deutschen Gesundheitssystem auskennen. Hinzu kämen geringe Deutschkenntnisse, die die Verständigung erschwerten und längere Gesprächszeiten erforderten.
Die Patienten in der Allgemeinmedizinischen Praxis am Campus zu behandeln, sei oft aufwendiger, als bei Patienten, die sich an die 116 117 wenden würden, resümiert die KV RLP.
Die Kosten für den Betrieb der APC sind beachtlich: Von den insgesamt 730 .200 Euro/pro Jahr werden 654 .600 Euro für das Personal ausgegeben (drei angestellte Ärzte sowie sieben medizinische Fachkräfte).
Den Ausgaben stehen Einnahmen von rund 264 .600 Euro gegenüber. Von diesen Einnahmen werden rund 70 Prozent aus den GKV-Leistungen generiert.

Eingang zur APC in Mainz
© Anke Thomas
Der übrige Anteil (84 .000 Euro) wird nach Angaben der Kassenärztlichen Vereingung von den gesetzlichen Krankenkassen in Rheinland-Pfalz getragen, die im APC-Modellprojekt 20 Euro pro Patient für die SmED-Ersteinschätzung an die KV zahlen.
Verluste erheblich
Aktuell muss die KV RLP durch den Betrieb der APC einen Verlust von rund 465 .000 Euro pro Jahr tragen. Dieser Verlust entstehe dadurch, dass mit einer deutlich höheren Patientenzahl aufgrund der Angaben der Unimedizin sowie mit einem geringeren Zeitaufwand pro Behandlungsfall gerechnet worden sei.Weil die APC sehr teuer ist, empfiehlt die KV RLP, die Anzahl der Standorte von Integrierten Notfallzentren zu begrenzen und Orte in Ballungsräumen zu wählen, an denen große Krankenhäuser betrieben werden. In Rheinland-Pfalz schlägt die KV maximal acht Standorte für INZ vor. Diese Standorte könnten laut KV RLP beispielsweise Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier und Koblenz sein.
Das knappe Gut Arztzeit
„Die Finanzierung von INZ an nahezu allen Kliniken im Land würde riesige Defizite verursachen“, begründet Dr. Peter Heinz, Chef der KV RLP die vorgeschlagene begrenzte Anzahl von Standorten.Darüber hinaus sei die Zeit der Vertragsärzte ein knappes Gut. Wird diese in Integrierten Versorgungszentren benötigt, fehlt sie an anderer Stelle, warnt der KV-RLP-Chef. „Zudem“, so Heinz weiter, „wird durch eine Dienstverpflichtung während der regulären Praxisöffnungszeiten die wirtschaftliche Existenz der Praxen der dienstverpflichteten Ärztinnen und Ärzte gefährdet. Finanziell und arbeitsrechtliche Auswirkungen auf das Praxispersonal kämen hinzu.“
Patienten, die kein INZ in der Nähe ansteuern könnten, könnten – wenn die Vertragsarztpraxen geschlossen hätten – über den Ärztlichen Bereitschaftsdienst versorgt werden, so die Idee der KV RLP.
Um die Kosten/Einnahmenlücke – zumindest in der APC – zu schließen, schlägt die KV zwei Maßnahmen vor: Zum einen müsste der Zuschuss der Krankenkassen pro Patient angehoben werden. 20 Euro findet die KV RLP zu wenig. Zum anderen müsste die Patientensteuerung ausgeweitet, also mehr Patienten ersteingeschätzt werden. In Mainz könne dies beispielsweise dadurch geschehen, dass weitere Notaufnahmen der Unimedizin das Ersteinschätzungsangebot der APC in Anspruch nehmen.
Kurzfristig könne dies durch Information und Aufklärung von Personal der Notaufnahmen und Patienten realisiert werden. Mittelfristig, so ein weiterer Vorschlag der KV RLP, müsse die APC vor einer zentralen Notaufnahme aller Fachrichtungen der Unimedizin vorgeschaltet werden.
BETRIEB
Die APC ist ein Eigenbetrieb der KV RLP mit drei angestellten Ärztinnen und Ärzten sowie sieben medizinischen Fachkräften.
LAGE
Sie befindet sich in der Unimedizin Mainz direkt vor der konservativen Notaufnahme.
ÖFFNUNGSZEITEN
Die Praxis hat von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr (Ausnahme Feiertage) geöffnet.
LAUFZEIT
Das Projekt läuft vier Jahre.
GESETZLICHE GRUNDLAGE
Die Rechtsgrundlage für die KV-eigene Praxis ist Paragraf 63 ff. SGB V. Es besteht ein Modellprojektvertrag mit den Krankenkassen in Rheinland-Pfalz.
PATIENTENSTEUERUNG MIT TELE-SOFTWARE
Die Software SmED (Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland) ist ein Medizinprodukt der Klasse I. Der Einsatz von SmED und dessen Steuerungswirkungen werden im Rahmen eines bundesweiten Versorgungsforschungsprojekts des Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses evaluiert. Die KV RLP ist neben zehn weiteren KVen Konsortialpartner im Projekt. Die APC ist Teststandort der KV RLP von SmED.
LEISTUNGSSPEKTRUM
Diagnostik und Therapie akuter Gesundheitsstörungen gehören zum Leistungsspektrum, nicht aber Präventivleistungen und Wiedereinbestellungen.
FINANZIERUNG
Finanziert wird die APC von der KV RLP und den Krankenkassen in Rheinland-Pfalz. Dabei vergüten die Krankenkassen die medizinische Ersteinschätzung nach Angabe der KV RLP mit einer Pauschale je Fall in Höhe von 20 Euro















