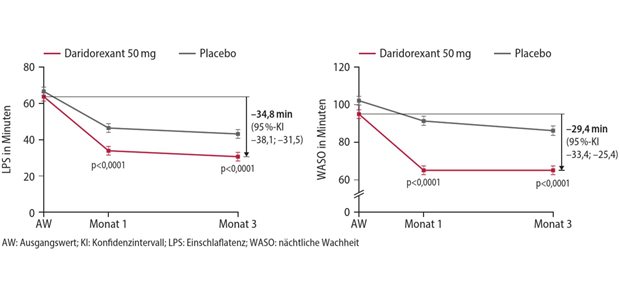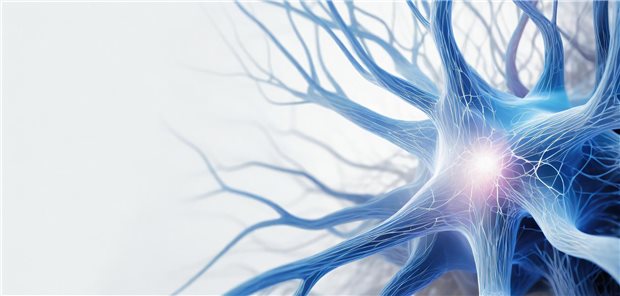PPP-Richtlinie
Personalvorgaben für die Psychiatrie werden oft nicht eingehalten
Der GKV-Spitzenverband sieht nicht nur den Fachkräftemangel als Ursache für eine oft unzureichende Personalbesetzung in den psychiatrischen Kliniken. DGPPN und DKG bekräftigen ihre Kritik an der jetzigen Form der Mindestvorgaben.
Veröffentlicht: | aktualisiert:
In vielen psychiatrischen Krankenhäusern herrscht Personalnotstand.
© Christoph Schmidt/picture alliance
Berlin. 40 Prozent der psychiatrischen Krankenhäuser haben im zweiten Halbjahr 2021 nach Angaben des GKV-Spitzenverbandes die Mindestpersonalvorgaben nicht eingehalten. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie seien es sogar 50 Prozent gewesen. Das belegten erste Auswertungen über die Personalausstattung in psychiatrischen Krankenhäusern, die das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) vorgelegt habe.
Seit 2020 regelt die Richtlinie über die Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-Richtlinie), die Anzahl der Personen, die in einem psychiatrischen Krankenhaus mindestens anwesend sein muss.
Kassen plädieren für mehr ambulante Versorgung
„Dass jedes dritte psychiatrische Krankenhaus die Personalmindestvorgaben nicht einhält, macht uns große Sorgen und belegt, wie wichtig die Personaldokumentation in der Patientenversorgung ist“, kommentiert die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes Dr. Doris Pfeiffer die Zahlen. Dabei berücksichtige die PPP-Richtlinie weitreichende Ausnahmen, wie zum Beispiel in der Corona-Pandemie. So könnten Krankenhäuser unter anderem bei überdurchschnittlichem hohem Krankenstand von den Personalvorgaben abweichen oder in begrenztem Umfang auf unqualifizierte Hilfskräfte zurückgreifen, um die Patientenversorgung sicherzustellen.
Schneller als die Ampel
Psychotherapieplätze: Rheinland-Pfalz fordert Reform der Bedarfsplanung
Für den GKV-Spitzenverband sind die niedrigen Erfüllungsquoten nicht nur Ausdruck des Fachkräftemangels, sondern auch Beleg für ein strukturelles Problem in der psychiatrischen Versorgung. In den meisten europäischen Ländern seien in den vergangenen 20 Jahren stationäre Kapazitäten abgebaut worden. Eine adäquate Therapie müsse nicht immer vollstationär erfolgen. Bisher würden in den deutschen Kliniken bestehende Alternativen aber viel zu selten genutzt. „Modellvorhaben zeigen, dass durch eine intensive Behandlung in Tageskliniken und psychiatrischen Institutsambulanzen die stationäre Verweildauer erheblich reduziert werden kann“, heißt es. Das sei nicht nur im Sinne der Patienten, sondern ermögliche auch einen zielgerichteten Personaleinsatz.“
Die DGPPN zieht ganz andere Schlüsse aus dem Bericht
Ganz anders interpretiert die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) den IQTIG-Bericht. Er zeige, dass ein großer Teil der Kliniken der Erwachsenenpsychiatrie die Personalvorgaben der Richtlinie bereits umsetze, heißt es bei der DGPPN. Fast alle Häuser beschäftigten die insgesamt vorgegebene Anzahl an Mitarbeitenden. Allerdings gebe es große Unterschiede. „Während die Personalvorgaben für die behandelnden Ärzte und Psychologen von fast allen Kliniken umgesetzt werden können, fehlen beispielsweise in jeder fünften Einrichtung Spezialtherapeuten“, so die DGPPN. Insgesamt hätten 40 Prozent der Kliniken Schwierigkeiten, die Personalvorgaben in allen sechs Berufen gleichzeitig zu erfüllen. Sie dafür mit Strafen zu belegen, wie es die PPP-Richtlinie ab 2024 vorsehe, ist aus Sicht der DGPPN weder hilfreich noch zielführend. „Wie so viele Bereiche der Gesundheitsversorgung leidet auch die Psychiatrie unter Fachkräftemangel. Statt horrender Bußgelder, die voraussichtlich nicht nur den Versorgungsauftrag, sondern auch die Existenz von Krankenhäusern gefährden werden, benötigen die Einrichtungen Unterstützung bei der Besetzung offener Stellen“, sagt DGPPN-Präsident Professor Andreas Meyer-Lindenberg. Der allgemeine Mangel an qualifiziertem Personal könne nicht von den psychiatrischen Kliniken allein behoben werden, dafür brauche es auch mehr Unterstützung aus Politik und Selbstverwaltung.
Nicht alle Berufsgruppen gleich relevant für die Patientensicherheit
Pauschale Interpretationen lasse der IQTIG-Bericht ohnehin nicht zu, da die Kliniken mit Blick auf die Personalausstattung in den verschiedenen Berufsgruppen zu heterogen aufgestellt seien. Dadurch zeige sich ein weiteres Problem der PPP-Richtlinie, sie unterscheide im Hinblick auf die Sanktionen nicht zwischen den Berufsgruppen. „Es dürfte aber unstrittig sein, dass es für die Patientensicherheit in einer Klinik – und nur darauf beziehen sich die Mindestvorgaben – einen Unterschied macht, ob ich zu wenig Ärzte und Pflegende habe, oder ob es sich um andere Berufsgruppen handelt“, sagt Meyer-Lindenberg.
Im vergangenen Jahr habe der G-BA beschlossen, die Sanktionen für Krankenhäuser, welche die strikten Vorgaben der Richtlinie nicht erfüllen könnten, für ein weiteres Jahr auszusetzen. Zudem sei eine weitere Anpassung bis Ende 2025 vorgesehen, die zu einer leitliniengerechten Behandlung beitragen solle. Das sehe die DGPPN durchaus positiv, sie setze sich aber weiter für die Streichung der pauschalen Sanktionen und für ein gestuftes System aus Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen für die Kliniken ein, heißt es aus der Fachgesellschaft.
Für die DKG stimmt etwas mit dem Mindestvorgabensystem nicht
Auch für die Deutsche Krankenhausgesellschaft sind die IQTIG-Zahlen ein Beleg dafür, dass das System der Mindestvorgaben an der Realität vorbei geht. Das Problem sei, dass die Mindestvorgaben nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) als nicht erfüllt gälten, wenn sie auch nur in einer einzigen von sechs Berufsgruppen nicht eingehalten werden könnten. Dazu zählen Ärzteschaft, Psychologie, Pflege, Spezialtherapie, Bewegungstherapie sowie Sozialarbeit. „Fehlt also eine Viertelstelle einer bestimmten Berufsgruppe, fällt das gesamte Krankenhaus aus dem Raster, selbst wenn die tatsächliche Besetzung bei anderen Berufsgruppen diesen fehlenden Stellenanteil überkompensiert“, so die DKG.
Nur mit Galgenhumor seien die Vorwürfe zu ertragen, dass zu viel stationär versorgt werde, heißt es bei der DKG. Wo seien die Anstrengungen der Kassen, mehr ambulante Behandlungen zu fördern? Das Gegenteil sei eher der Fall. Patientinnen und Patienten nicht mehr stationär zu versorgen hieße in vielen Fällen, sie gar nicht zu versorgen, weil die Ressourcen im ambulanten Bereich fehlten oder die Kassen sich weigerten, den Kliniken eine ambulante Behandlung zu finanzieren. (chb)