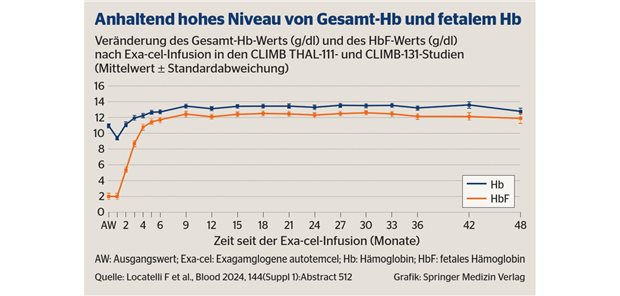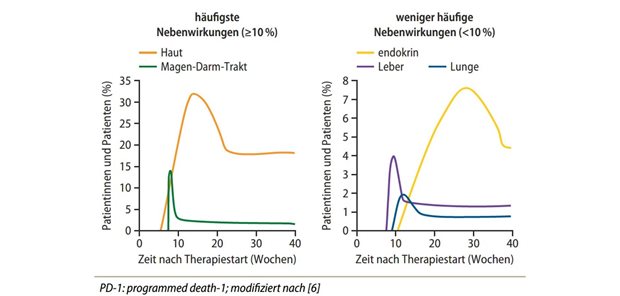Forschung
Regierung setzt auf KI in der Krebsmedizin
Forschungsministerin Karliczek ruft dazu auf, in der Krebsbehandlung stärker auf Künstliche Intelligenz zu setzen. Viele Ansätze steckten jedoch noch in den Kinderschuhen, so die CDU-Politikerin.
Veröffentlicht:
Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) stellte das Projekt „Cancer Scout“ vor, das erforschen soll, ob es möglich ist, mit Hilfe von KI molekulare Veränderungen in Tumoren zu erkennen, um sie wirksamer behandeln zu können.
© Jörg Carstensen/dpa
Berlin. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kann laut Bundesregierung Diagnose und Behandlung von Krankheiten verbessern. „KI ist für uns Menschen einen Riesengewinn, gerade in der Medizin wird das ganz deutlich“, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Donnerstag.
Es gehe darum, Arzt und Technik zu verbinden. Im „Idealfall“ ergänze sich beides. Ein gutes Beispiel dafür sei das Projekt „Cancer Scout“. Das Forschungsministerium unterstützt das Vorhaben mit zehn Millionen Euro.
Im Kern geht es dabei um eine Art Vorscreening von Tumorzellen, wie der Direktor der Pathologie am Universitätsklinikum Göttingen und Leiter des Projekts, Professor Philipp Ströbel, erläuterte. Mithilfe von KI würden Rechner Tumorzellen in bestimmte Raster – molekulare Subgruppen – unterteilen. Auf diese Weise ließen sich Krebspatienten gezielter behandeln. Es bestehe die Chance, ein „ganzes Bündel“ neuartiger Methoden für die klinische Routine zu entwickeln.
Präzisere Krebsdiagnostik durch KI?
Christian Wolfrum, Leiter „New Business Development“ bei Siemens Healthineers, sagte, das Forschungsprojekt könne helfen, verschiedene Datenquellen zu nutzen und zu verknüpfen, um die Krebsdiagnostik präziser und dadurch besser zu machen.
Sie sei sich bewusst, dass viele KI-Ansätze in den Kinderschuhen steckten und besser erforscht werden müssten, so Karliczek. Die Bundesregierung stelle daher 90 Millionen Euro für über 60 Vorhaben bereit, die sich gezielt mit KI in der Medizin beschäftigten. Diese „Zukunftsinvestitionen“ sollten nach Möglichkeit weiter aufgestockt werden.
Die Technologie sei „überraschend nah am Alltag der Menschen“, machte Pathologe Ströbel deutlich. „Wir arbeiten heute noch überwiegend analog.“ Das gelte besonders für den Medizinbetrieb. „Ganz viele Daten, die wir eigentlich bräuchten, sind in irgendwelchen Aktenbergen versteckt. Das ist ein Problem.“ Ziel müsse sein, „die Daten liquide zu machen, um sie für smarte Anwendungen nutzen zu können“.
KI – im Auto längst selbstverständlich
Medizin in Deutschland sei hochgradig arbeitsteilig organisiert, was dazu führe, dass viele Disziplinen nebeneinander her arbeiteten, so Ströbel. Dadurch könnten wichtige Details verloren gehen. Es wäre daher wünschenswert, wenn Ärzte auf KI-gestützte Assistenzsysteme zurückgreifen könnten, „die im Auto schon längst selbstverständlich sind“.
Auch bei der OP- und Dienstplanung könne KI zum Einsatz kommen, um Abläufe und notwendige Personaleinsätze besser überblicken und priorisieren zu können, betonte der Pathologe.
Weniger wertige wie Schreib- und Büroaufgaben ließen sich an KI-Systeme „delegieren“, um Ärzte und Pflegekräfte bei den Aufgaben zu entlasten, die „nur von Menschen übernommen werden können“. Darin stecke auch eine „realistische Chance“, die durch Zeit-, Kosten- und vor allem Personaldruck angespannte Situation in vielen medizinischen Einrichtungen zu entlasten. (hom)