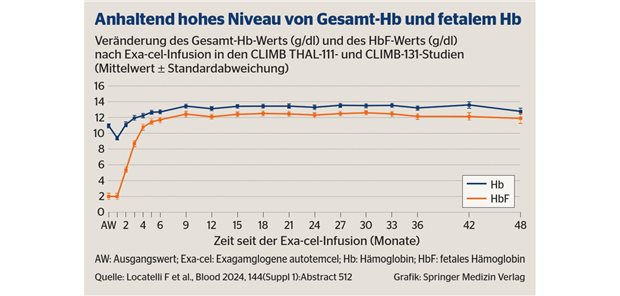Krebschirurgie
Brustrekonstruktion nach Mammakarzinom: Das sind die Fakten
Bei den vielen neuen Verfahren zur Brustrekonstruktion nach Mammakarzinom den Überblick zu behalten, ist nicht leicht. Randomisierte Daten fehlen oft. Beim Krebskongress gab es ein Update mit neuerer Evidenz.
Veröffentlicht:
Chirurgie bei Mamma-Ca. Geht es um die Rekonstruktion, bevorzugen viele Frauen Optionen, bei denen Eigengewebe genutzt wird.
© Georgiy / stock.adobe.com
Berlin. Anders als bei den Systemtherapien beim Mammakarzinom, wo zu nahezu jeder Fragestellung randomisierte, kontrollierte Studien (RCT) möglich sind und gefordert werden, sei die Durchführung von RCT in der rekonstruktiven Brustchirurgie oft schwierig, erinnerte Professor Jens-Uwe Blohmer von der Gynäkologie der Charité Berlin am Campus Mitte.
Leitlinien wie die gerade in Aktualisierung befindliche S3-Leitlinie Brustrekonstruktion seien deswegen oft auf Kohortenstudien und andere Formen kontrollierter Datenerhebungen angewiesen.
Acht von zehn Frauen werden brusterhaltend operiert
Blohmer gab beim Deutschen Krebskongress (DKK 2022) einen Überblick über zahlreiche aktuelle Fragen im Zusammenhang mit der Brustrekonstruktion und präsentierte neuere Evidenz. Prinzipiell sei die brusterhaltende Therapie (BET) in Deutschland etabliert: „Aktuell werden circa 80 Prozent der Patientinnen brusterhaltend operiert.“
Die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) gebe der Aussage, dass die Überlebensraten nach BET, bestehend aus Tumorentfernung und Radiotherapie, mindestens äquivalent seien zu denen nach Mastektomie, einen Evidenzlevel 1a und Evidenzgrad A.
Spannend sei eine kürzlich publizierte, schwedische Kohortenstudie auf Basis des dortigen nationalen Brustkrebsregisters. Sie bezieht sich auf Patientinnen mit T1-2 N0-2-Tumoren ohne Metastasen. Dort zeigte sich bei BET mit Radiatio ein 5-Jahres-Überleben von 91,1 Prozent, was in etwa jenen 88 Prozent entspreche, die in Deutschland derzeit erreicht würden.
Die Schweden folgern nun auf Basis ihrer Registerdaten, dass die Mastektomie nicht mehr als der BET gleichwertig angesehen werden sollte. Denn das Gesamtüberleben bei Mastektomie war signifikant schlechter, auch dann, wenn sie mit Radiotherapie kombiniert wurde (de Boniface J et al. JAMA Surg 2021; 156(7):628-637).
Onkoplastische Operationen können Mastektomien ersetzen
Das Spektrum der Operationsmöglichkeiten bei brusterhaltenden Therapiestrategien ist allerdings breit, sodass sich die Frage stellt, ob und wenn ja wo es Unterschiede im Operationsergebnis bzw. langfristigen Abschneiden der Patientinnen gibt.
Blohmer stellte einige Ergebnisse der internationalen, multizentrischen, retrospektiven OPBC-01/iTOP2 Studie vor, die konventionelle BET mit einer onkoplastischen Operation verglichen hat, also einem Eingriff, der Prinzipien der ästhetischen Chirurgie mitberücksichtigt. Das mediane Follow-up der Studie lag bei gut sechs Jahren (Fitzal F et al. Ann Surg Oncol 2022; 29:1061-1070).
Das Ergebnis sei sehr interessant, so Blohmer. Nach multivariater Analyse für Tumorbiologie, Tumorgröße und sonstiger Therapie gab es keinen Unterschied zwischen den Gruppen beim erkrankungsfreien Überleben, der Lokalrezidivrate, dem metastasenfreien Überleben oder dem Gesamtüberleben. Allerdings waren die Tumore beim onkoplastischen Eingriff größer, die Nachresektionsrate bei konventioneller BET war höher.
Insgesamt spreche diese Studie dafür, dass die onkoplastische Operation zwar keine Überlegenheit gegenüber der konventionellen BET habe, aber die Mastektomie ersetzen könne bzw. brusterhaltende Strategien auch bei etwas größeren Tumoren ermöglichen könne.
Primäre oder sekundäre Rekonstruktion machen keinen Unterschied
Blohmer stellte noch zahlreiche weitere Kohortenstudien vor, die unterschiedliche Fragestellungen bei der rekonstruktiven Chirurgie beleuchteten, basierend auf einem systematischen Review des US-amerikanischen Effective Health Care Program (Saldanha IJ et al. AHRQ Publication No 21-EHC027).
So sprächen die derzeit verfügbaren Daten dafür, dass es für das onkologische Outcome unerheblich ist, ob die Brust sofort beim Tumoreingriff oder erst sekundär rekonstruiert werde.
Bei der Frage „Eigengewebe oder Implantat“ sei die globale Patientinnenzufriedenheit bei den autologen Rekonstruktionen (AR) höher als bei den implantatbasierten Rekonstruktionen (IBR).
Allerdings seien die generelle Lebensqualität und die psychosoziale Zufriedenheit vergleichbar. Das Risiko thromboembolischer Ereignisse sei bei AR höher, demgegenüber haben IBR ein höheres Risiko von Langzeitkomplikationen.
Muskelsparende Techniken reduzieren Komplikationen
Wenig wissenschaftliche Klarheit gibt es bei der Frage, ob bei IBR ein sub- oder epimuskuläres Implantat bevorzugt werden sollte: „Es gibt keine ausreichende Evidenz, um Unterschiede zwischen präpektoralen und partiell submuskulären bzw. partiell submuskulären und komplett submuskulären Implantatrekonstruktionen erkennen zu können“, so Blohmer.
Auch die Frage, ob bei einer IBR eine humane azelluäre dermale Matrix genutzt werden sollte oder nicht, lasse sich derzeit nicht mit harter Evidenz beantworten.
Ähnliches gilt für die Frage, ob Rekonstruktionen mit gestieltem transversalem Rectus-Muskel (TRAM) oder freiem tiefen inferioren epigastrischen Perforatorlappen (DIEP) bevorzugt werden sollte. Die TRAM-Rekonstruktion gehe mit erhöhten Komplikationsraten in der Spenderregion, also der Bauchwand einher, so Blohmer.
Unabhängig von der verwendeten Methode sollten muskelsparende Techniken bevorzugt werden, um Komplikationen zu minimieren. Das ist auch AGO-Empfehlung.