Infektiologie
Artemisinin-Resistenz bei Malariaparasiten entschlüsselt
Plasmodien brauchen Hämoglobin, um zu überleben. Abbauprodukte von Hämoglobin machen aber Artemisinin „scharf“. Störungen in diesen Prozessen der Nahrungsaufnahme und Artemisinin-Aktivierung führen zu Resistenzen.
Veröffentlicht: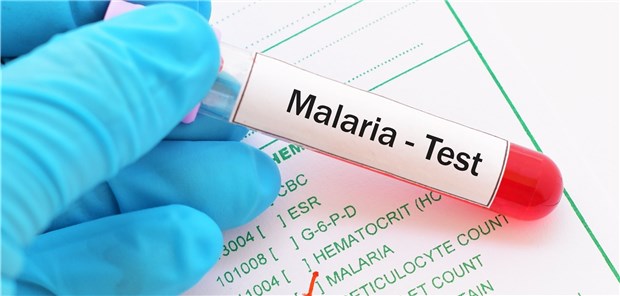
Test auf Malaria: Ist er positiv, kommt häufig Artemisinin zum Einsatz.
© jarun011 / stock.adobe.com
Hamburg. Forscher haben geklärt, warum Artemisinin, ein wichtiges Malaria-Mittel, gegen Plasmodien manchmal nicht wirkt (Science 2020; 367, 6473: 51-59). Bei Resistenzen gegen die Arznei habe das Parasitenprotein Kelch13 eine Schlüsselrolle, meldet das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM).
Plasmodium falciparum, der Erreger der Malaria tropica, sei mit jährlich über 200 Millionen Neuinfektionen und mit über 400.000 Todesfällen einer der bedeutendsten Infektionserreger des Menschen, erinnert das BNITM.
Um die Malaria zu behandeln, würden in erster Linie Kombipräparate eingesetzt, die Artemisinin enthalten. Allerdings sei der Erfolg dieser Behandlung durch Resistenzen des Erregers zunehmend bedroht.
Mutationen im Protein „Kelch13“
Bisher sei ein Zusammenhang zwischen Mutationen im Protein „Kelch13“ des Malariaparasiten und dem Auftreten von Artemisinin-Resistenzen bekannt gewesen, resümiert das BNITM. „Es war jedoch bislang unklar, welche Funktion Kelch13 in der Parasitenzelle ausübt und wie Kelch13-Mutationen Resistenz verursachen.“
Malariaparasiten vermehren sich ja in Erythrozyten und ernähren sich durch Aufnahme und Verdauung von Hämoglobin. Die Arbeitsgruppe um Tobias Spielmann am BNITM hat jetzt zusammen mit Kooperationspartnern von der Radboud Universität in Nijmegen aus den Niederlanden festgestellt, dass Kelch13 mit anderen Proteinen zusammenwirkt, die für die Aufnahme des Hämoglobins in die Parasitenzelle verantwortlich sind, wie es in der Mitteilung des Instituts heißt.
„Erst die Identifikation von Kelch13-Partnerproteinen hat uns den entscheidenden Hinweis gegeben, welche Funktion Kelch13 in der Parasitenzelle ausüben könnte“, wird Spielmann zitiert. „Die gezielte Inaktivierung von Kelch13 bestätigte diese Vermutung und führte in der Tat zu einer verminderten Hämoglobin-Aufnahme.“
Artemisinin muss aktiviert werden
Um seine toxische Wirkung entfalten zu können, muss Artemisinin nach Aufnahme in die Parasitenzelle aktiviert werden: Der Malariaparasit nimmt Hämoglobin auf, verdaut dieses und produziert dabei Abbauprodukte. Diese Abbauprodukte aktivieren ihrerseits Artemisinin, der Parasit stirbt, erklärt das BNITM in seiner Mitteilung.
In weiteren Experimenten hätten die Forscher gezeigt, dass die bekannten Kelch13-Mutationen die Hämoglobinaufnahme in die Parasitenzelle vermindern. Dadurch entstehen weniger Hämoglobinabbauprodukte und Artemisinin wird nicht mehr ausreichend aktiviert, um den Parasiten abtöten zu können.
„Eigentlich handelt es sich bei der Arteminisin-Resistenz um eine sehr feinsinnige Balance zwischen Nahrungsaufnahme und Artemisinin-Aktivierung“, so Spielmann in der BNITM-Mitteilung. „Zum einen muss der Parasit trotz verringerter Hämoglobinaufnahme noch genügend Nahrung zu sich nehmen, um zu überleben, zum anderen darf er gerade nur so viel Hämoglobin aufnehmen, dass Artemisinin nicht mehr ausreichend aktiviert wird.“
Die Erkenntnisse könnten helfen, verbesserte Malariamedikamente zu entwickeln, um der zunehmenden Artemisinin-Resistenz zu begegnen. (eb)











