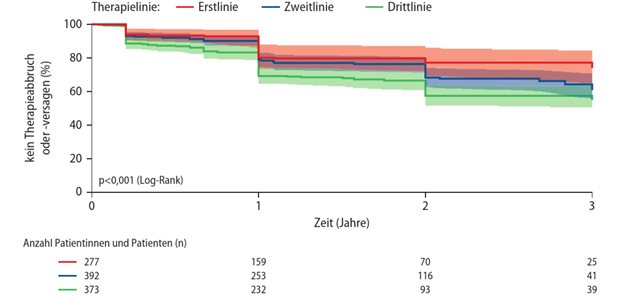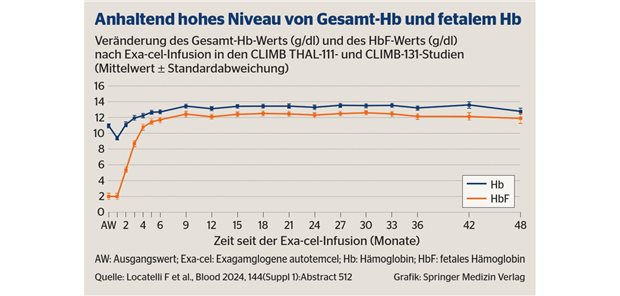Auswertung des SEER-Registers
Darmkrebs: Geringes Einkommen, schlechte Prognose
Finanziell schlecht gestellte Darmkrebspatienten sterben früher an dem Tumor als gut situierte Personen – auch bei gleicher Therapie.
Veröffentlicht: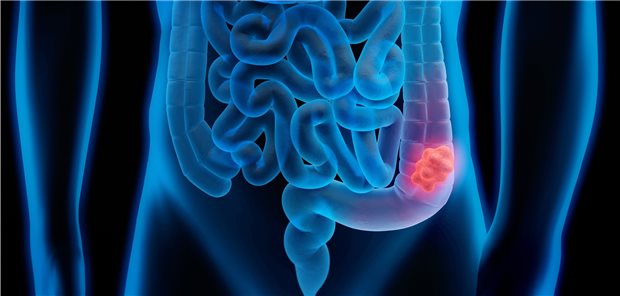
Darmkrebs: Sterben Betroffene aus ärmeren Schichten früher an dem Tumor, weil sie häufiger Begleiterkrankungen oder einen ungesunden Lebensstil haben?
© psdesign1 / stock.adobe.com
Das Wichtigste in Kürze
Frage: Gibt es bei ähnlichen Tumoren und Therapien Nachteile für ärmere Patienten?
Antwort: In einer Analyse von SEER-Register-Daten lebten reichere Kolonkarzinompatienten länger als ärmere, auch starben sie seltener an Darmkrebs – trotz leitliniengerechter Standardtherapie.
Bedeutung: Bei vergleichbaren Tumoren und Therapien haben ärmere US-Bürger schlechtere Überlebenschancen.
Einschränkung: Begleiterkrankungen und Lebensstilfaktoren wurden nicht berücksichtigt.
Für die Analyse berücksichtigten Internisten und Onkologen um Dr. Amina Dhahri von der Uni in Largo bei Washington D.C. ausschließlich Patienten mit einem Stadium-III-Adenokarzinom des Kolons, die nach einer kurativ beabsichtigten Resektion eine adjuvante Chemotherapie erhalten hatten.
Hier gingen sie davon aus, dass die Behandlung in allen Fällen sehr ähnlich ist. Sie fanden im SEER-Register mehr als 27 .200 Patienten, die sich in den Jahren 2004–2015 einer solchen Therapie unterzogen hatten und schauten nach dem Gesamt- und krebsspezifischen Überleben in den Folgejahren. Die Forscher differenzierten dabei nach dem sozioökonomischen Status: Sie bildeten fünf ähnlich große Gruppen basierend auf Haushaltseinkommen, Miete, Ausbildung, Immobilienwert und Beschäftigungsstatus.
Krebsspezifische Mortalität um ein Viertel höher
Wie sich zeigte, war der Anteil von Afroamerikanern in den unteren Schichten deutlich höher als in den oberen (27 Prozent versus 5 Prozent), ähnliches galt für Latinos (17 Prozent versus 6 Prozent), umgekehrt verhielt es sich mit Asiaten (5 Prozent versus 16 Prozent). Ärmere Patienten lebten häufiger auf dem Land und waren öfter nicht versichert oder Medicaid-versichert als wohlhabendere, auch hatten sie etwas häufiger ein höheres T-Stadium und weniger Lymphknotenuntersuchungen als reichere Patienten. Ansonsten gab es keine großen Unterschiede bei den Tumorcharakteristika.
Die Patienten konnten im Median knapp sechs Jahre nachbeobachtet werden, in dieser Zeit starben 8063 von ihnen (30 Prozent), bei fast 6000 wurde der Tod auf das Kolonkarzinom zurückgeführt (22 Prozent ). Im Quintil mit dem niedrigsten sozioökonomischen Status lag das mediane Gesamtüberleben (OS) bei 9,4 Jahren, im Quintil mit dem zweitniedrigsten waren es 10,8 Jahre, für alle anderen Schichten ließ sich das mediane OS noch nicht bestimmen.
Schauten die Ärzte um Dhahri nach dem Fünfjahresüberleben, so fanden sie einen Anteil von 66 Prozent in der untersten und 75 Prozent in der obersten Schicht. Wurden Ethnie, Alter, Geschlecht, Versicherung und Tumorcharakteristika berücksichtigt, lag die Sterberate im untersten Quintil um ein Drittel höher als im obersten. Betrachteten die Ärzte nur die krebsspezifische Mortalität, schwächte sich der Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status etwas ab, blieb aber immer noch markant: In der untersten Schicht war die Sterberate um 23 Prozent höher als im wohlhabendsten Teil der Bevölkerung.
Afroamerikaner wiesen unabhängig von anderen Faktoren eine 29 Prozent höhere Sterberate auf als weiße US-Bürger, Latinos eine 11 Prozent höhere. Für andere Ethnien gab es keine statistisch belastbaren Abweichungen zur weißen US-Bevölkerung.
Mehr Begleiterkrankungen als Ursache vermutet
Trotz leitliniengerechter Therapie war die Prognose in den sozioökonomisch benachteiligten Schichten deutlich schlechter als bei den gut situierten US-Bürgen, so das Fazit der Autoren. Weshalb, bleibt jedoch unklar.
Ein wichtiger Faktor dürfte eine höhere Rate von Begleiterkrankungen bei sozial schwächeren Bürgern sein, diese können das OS sowie das krebsspezifische Überleben beeinträchtigen. Begleiterkrankungen wurden aber nicht erfasst, ebenso wenig Lebensstilfaktoren. Eine höhere Grundmorbidität, weniger Bewegung, schlechte Ernährung sowie ein erhöhter Tabak- und Alkoholkonsum könnten daher zur erhöhten Darmkrebsmortalität beigetragen haben.
Hinzu kommt vielleicht eine schlechtere Nachbetreuung mit selteneren Kontrolluntersuchungen so wie finanzielle Einbußen: Wer bei der Diagnose noch arbeitet, verliert oft seinen Job, und das hat für sozial Benachteiligte oft gravierendere Konsequenzen als für Bessergestellte. Schließlich können sich reichere US-Bürger auch qualifiziertere Chirurgen und modernere Therapien leisten, dies dürfte die Prognose ebenfalls zu ihren Gunsten verbessern.