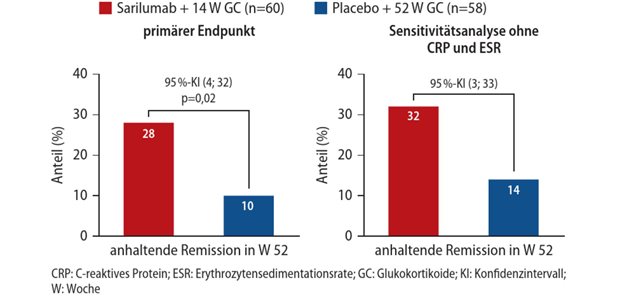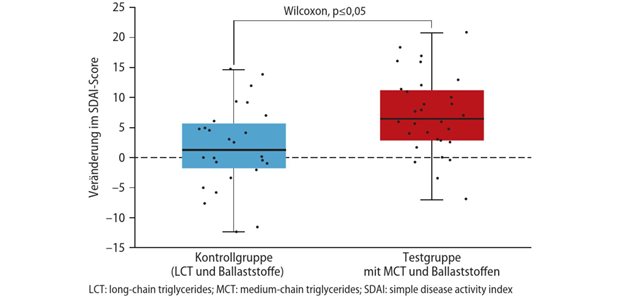Osteoporose
Die Milch macht’s wohl doch nicht
Milchprodukte sind gut für die Knochen, heißt es immer wieder. Träfe das zu, könnten Frauen im Übergang zur Menopause vom Verzehr profitieren, und zwar im Sinne einer Osteoporose-Prävention. US-Forscher sind der Sache auf den Grund gegangen.
Veröffentlicht:
Milch, Butter, Käse: Zumindest nach einer neuen Datenanalyse sind solche Produkte nicht zur Prävention der Osteoporose geeignet.
© bit24/stock.adobe.com
Fairfax. „Die Milch macht’s“ – das war einst ein bekannter Slogan aus einer Imagekampagne der Milchwirtschaft. Hervorgegangen ist er aus dem Spruch „Milch macht müde Männer munter“, und es liegt vielleicht nicht nur an der Lust am Stabreim, dass darin von Frauen keine Rede ist. Denn den Frauen, müde oder nicht, scheinen Milchprodukte wenig zu nützen, jedenfalls mit Blick auf Knochendichte und Osteoporoseprophylaxe.
Eine Gruppe von Ernährungswissenschaftlern und Epidemiologen, angeführt von Taylor Wallace (George Mason University, Fairfax), hat die Daten von rund 3300 Teilnehmerinnen der Kohortenstudie SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation) auf den Zusammenhang zwischen dem Konsum von Milchprodukten, der Knochendichte und dem Frakturrisiko hin analysiert (Menopause 2020; online 11. Mai). Die Probandinnen gehörten zur Subkohorte von SWAN, bei der die Knochengesundheit im Vordergrund der Untersuchung stand.
Follow-up über zehn Jahre
Die Frauen dieser Subkohorte waren zu Beginn der Studie 1996 zwischen 42 und 53 Jahre alt und befanden sich vor oder in der frühen Perimenopause. Die Nachbeobachtungsphase erstreckte sich über zehn Jahre, in denen die Frauen jährlich nachuntersucht und wiederholt zu ihrer Ernährung befragt wurden.
Wallace und Kollegen teilten die Probandinnen in vier Kategorien ein, entsprechend der durchschnittlichen Zahl der Portionen an Milchprodukten, die sie täglich zu sich nahmen. Die Spanne reichte von < 0,5 bis ≥ 2,5 Portionen, wobei eine Portion beispielsweise aus 240 ml Milch, einem Becher Joghurt oder 28 g Käse bestehen konnte. Diese Angaben setzten die Wissenschaftler in Beziehung zum Verlust der Knochenmineraldichte über zehn Jahre hinweg, gemessen per Doppel-Energie-Röntgen-Absorptiometrie an Femurhals und Lendenwirbelsäule.
Keine signifikanten Unterschiede
Doch gleich, wie der Menopausenstatus der Frauen zu Beginn der Studie war – es ließen sich keine signifikanten Unterschiede in der Entwicklung der Knochendichte in Abhängigkeit vom Verzehr von Milchprodukten feststellen. Auch mit Blick auf nichttraumatische Frakturen war kein Unterschied zu erkennen. Allerdings war der Konsum unter den Studienteilnehmerinnen insgesamt gesehen relativ schwach ausgeprägt, nur sieben Prozent erfüllten die empfohlene Vorgabe von täglich drei Portionen an (Mager-)Milchprodukten.
In ihrem Fazit konstatieren Wallace und Mitarbeiter: „In SWAN ergaben sich keine Belege dafür, dass Frauen in mittleren Jahren in puncto Knochendichte oder Frakturen von Milchprodukten profitieren würden.“
Milch mag demnach, um einen weiteren Slogan anzuführen, gegen Maroditis helfen; vor Osteoporose schützt sie offenbar nicht.