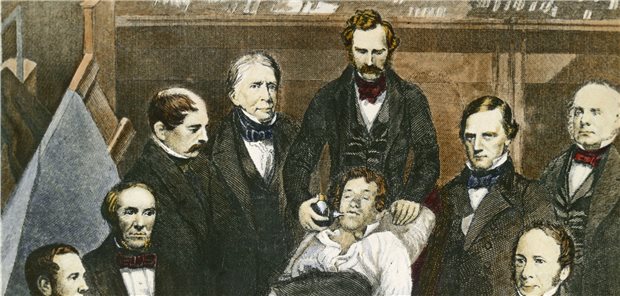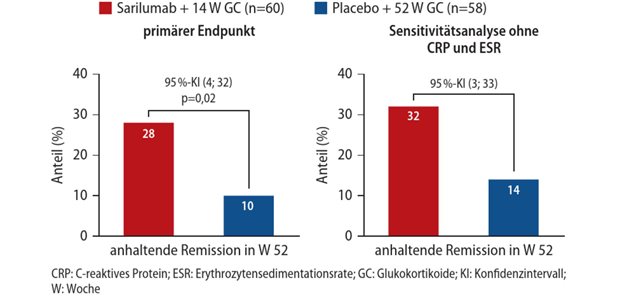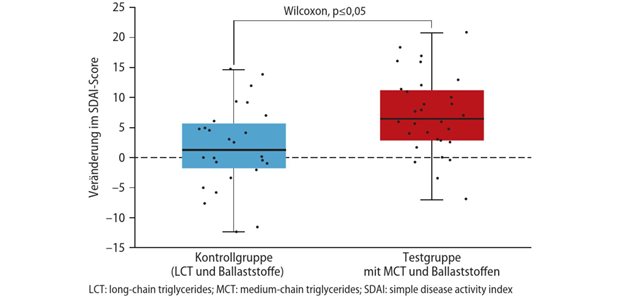175 Jahre Anästhesie
„Eine Aufgabe für kränkliche Mediziner“
Lange war „Narcotiseur“ lediglich ein Hilfsjob für Assistenten oder Krankenschwestern. Vor etwa 100 Jahren kamen Überlegungen auf, einen „Facharzt für Narkose“ zu etablieren.
Veröffentlicht:
Historisches Narkosegerät der Firma Draeger aus dem Jahr 1948 im Heimatmuseum in Kowary.
© Andreas Keuchel / picture alliance
Neu-Isenburg. Vor Einführung moderner Anästhesiemethoden waren chirurgische Eingriffe eher seltene und oft lebensbedrohliche Ereignisse. Heute werden allein an deutschen Krankenhäusern pro Tag (!) 40 .000 Narkosen vorgenommen, berichten die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) sowie der Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA). Hinzu kommen schätzungsweise mehrere Tausend weitere Narkosen in Arztpraxen und Behandlungszentren. Die Zahl schwerer Zwischenfälle oder gar Todesfälle sei dabei „so niedrig, dass sie kaum messbar ist“, so BDA und DGAI. Das war beileibe nicht immer so.
„Die Verwendung von Sauerstoff als Trägergas ermöglichte die Konstruktion der ersten ‚modernen‘ Narkoseapparate“, berichten die Medizinhistorikerin Dr. Heike Petermann aus Münster und der Anästhesiologe Professor Michael Goerig aus Hamburg (Anaesthesist 2016; 65:787–808). Seit 1905 konnte Sauerstoff industriell in Druckgasflaschen abgefüllt werden, mithilfe eines Druckminderer-Ventils war es möglich, den Sauerstoff in definierten Mengen zu entnehmen.
Für die Dosierung der volatilen Anästhetika wurden unterschiedliche Vapore entwickelt, zum Beispiel mit einer Dosierung nach Tropfenzahl pro Minute, mit dem Prinzip der Oberflächenverdunstung oder mit einem Sprudelsystem, um das Gasgemisch im flüssigen Anästhetikum anzureichern. „Diese unterschiedlichen Vapore ermöglichten nur eine annähernd genaue Dosierung“, so Petermann und Goerig. Außerdem nutzten die ersten Narkoseapparate ausschließlich mechanische Prinzipien.
Das Modell A
Das änderte sich erst im Jahre 1925 mit dem Lachgas-Sauerstoff-Narkoseapparat, Modell A, von Dräger. Dieser wies bereits alle Merkmale heutiger Narkosegeräte auf:
Getrennte Schläuche für Ein- und Ausatmung,
großflächige, federlose und widerstandsarme Glimmerplättchenventile,
Kohlensäureabsorber als Einwegpatrone,
Atembeutel zur manuellen Beatmung und
Entlüftungs- sowie Überdruckbegrenzungsventile.
Methoden zur Sicherung der Atemwege waren außer dem Esmarch-Handgriff die Einführung des Tubus nach Mayo (1925) und nach Guedel (1933). Friedrich Trendelenburg (1844–1924) hatte bereits 1869 bei intraoraler Op vor Op-Beginn eine Tracheotomie vorgenommen.
MacEwen, Kuhn und Kritzler
Der Brite William MacEwen (1848–1924) verwendete stattdessen einen biegsamen Metallschlauch, den er unter digitaler Kontrolle in die Trachea einführte und über den er dann auch das Narkotikum applizierte. Über „Die perorale Intubation“ hatte 1911 der Chirurg Franz Kuhn (1866–1929) berichtet. „Doch konnte diese sich aufgrund des erbitterten Widerstands des Chirurgen Ferdinand Sauerbruch (1875–1951) nicht durchsetzen“, berichten Petermann und Goerig. Erst die Entwicklung des Laryngoskops erlaubte die Intubation unter Sicht und erst mit Einführung des Muskelrelaxans Curare wurde die Intubation zum Standardverfahren.
„Im Auslande hat mir eine Einrichtung ganz besonders gefallen, das ist die des Facharztes für Narkose“, bemerkte der Gynäkologe Hans Kritzler (1888–1960) im Jahre 1921 in der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift“. Dies könne eine Aufgabe für „kränkliche“ oder „schwerer kriegsbeschädigte Berufsgenossen“ sein. Im Jahre 1953 wurde der „Facharzt für Anästhesie“ in Deutschland eingeführt. Bereits im Vorjahr war die Zeitschrift „Der Anaesthesist“ begründet worden, die bis heute im Springer Medizin Verlag erscheint. In bundesdeutschen Krankenhäusern, Praxen und medizinischen Versorgungszentren arbeiten inzwischen fast 26 .000 Anästhesisten.