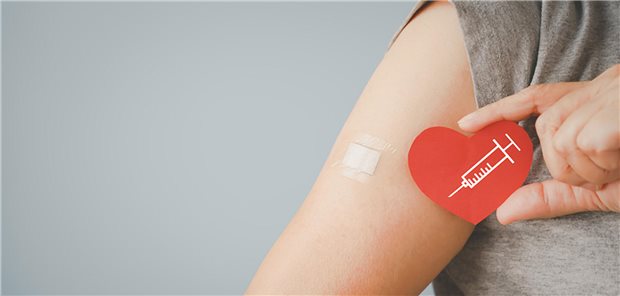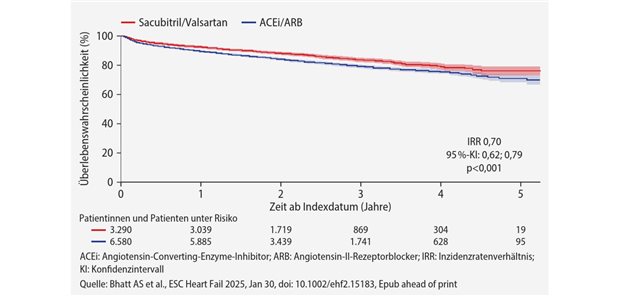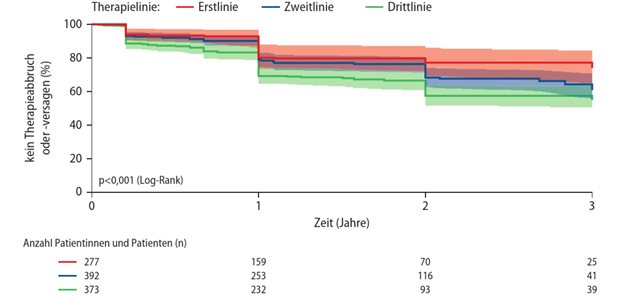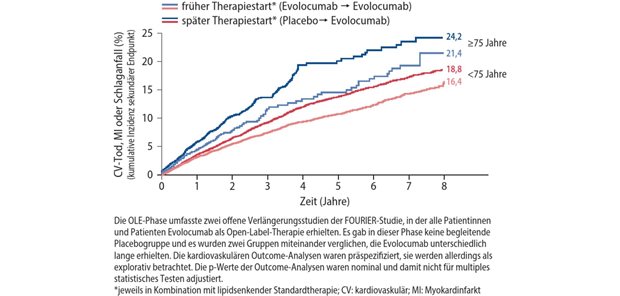Kasuistik
Erst Bauchweh, dann Herzinsuffizienz – OTC-Präparat wurde zur Bedrohung
Nach zwei Wochen anhaltenden Bauchschmerzen stellt sich eine 29-Jährige in der Notaufnahme vor. Sie entwickelt eine akute Herzinsuffizienz und kommt auf die Intensivstation. Erst eine Biopsie bringt Klarheit.
Veröffentlicht:
Hinter epigastrischen Beschwerden können in seltenen Fällen auch an kardiale Ursachen stecken. (Symbolbild mit Fotomodell)
© Nutlegal / stock.adobe.com
Fazit für die Praxis
Epigastrische Schmerzen können das Symptom einer kardialen Erkrankung sein.
Schnelle Diagnosestellung der Ätiologie einer Myokarditis ist essenziell, da diese wie im Falle einer nekrotisierenden eosinophilen Myokarditis lebensbedrohlich verlaufen kann.
Eine Bluteosinophilie kann weitreichende Untersuchungen erforderlich machen.
Der Auslöser einer Myokarditis lässt sich durch histologische Befunde herausfinden, für die Erkrankung ergibt sich dadurch gegebenenfalls eine spezifische und kurative Therapie.
Porto Alegre. Bei epigastrischen Beschwerden sollte man auch an kardiale Ursachen denken. Wie wichtig das sein kann, wird an einem Fallbericht deutlich eines Teams um Luís Beck-da-Silva deutlich (European Heart Journal – Case Reports 2021; online 9. August).
Dabei kommt eine 29-jährige Frau mit Bauchschmerzen in die Notaufnahme des Krankenhauses Moinhos de Vento in Porto Alegre in Brasilien. Bis auf ihre Migräne hat die Frau bis dato keine gesundheitlichen Probleme.
Bereits seit zwei Wochen habe sie diese Schmerzen, berichtet sie, mittlerweile auch im Brustbereich. Vor fünf Tagen wurde deshalb eine Magenspiegelung vorgenommen, deren Befunde allerdings keine Auffälligkeiten zutage brachte.
EKG auffällig und Eosinophilie
Auffallend ist dagegen der EKG-Befund der jungen Patientin, dieser zeigt ST-Streckensenkungen in den anterioren Ableitungen. Die Troponin-Werte sind mit 13,0 ng/ml stark erhöht (Referenzbereich <0,16 ng/ml), ebenso wie das C-reaktive Protein mit Werten von 13,5 mg/L.
Verdächtig ist zudem die ausgeprägte Eosinophilie im Blutaustrich (19 Prozent, 2810 Zellen/mm3). Stuhluntersuchung und Blutkulturen auf potenziell vorhandene Erreger sind negativ ausgefallen.
Fulminanter Myokarditis-Verlauf
In den folgenden Tagen verschlechtert sich der Zustand der Frau merklich: Sie leidet an Orthopnoe, Schwindel und Brustschmerz. Bei ihr ist ein dritter Herzton zu hören und ihre BNP-Konzentrationen sind mit >1200 pg/mL deutlich erhöht. Die Frau wird wegen des Verdachts auf eine akute Herzinsuffizienz in die Intensivstation verlegt, wo sie mit einer leitliniengerechten Herzinsuffizienz-Therapie behandelt wird.
Der fulminante Verlauf bestätigt die brasilianischen Kardiologen in ihrer Vermutung, dass die Patientin eine Myokarditis haben könnte. Bereits das kardiale MRT gab Hinweise darauf. Darin waren Ödeme und mittventrikuläre Fibrosen an der Lateralwand zu sehen. Die linksventrikuläre globale Kontraktilität war grenzwertig eingeschränkt.
Beck-da-Silva und Kollegen entscheiden sich daraufhin für eine empirische Therapie mit Prednison (60 mg/Tag per os). Die Herzinsuffizienz-Beschwerden der Frau lassen darunter etwas nach.
ZNS-Beteiligung
Doch die Leidensgeschichte der jungen Frau ist damit nicht zu Ende. Plötzlich entwickelt sie starke Kopfschmerzen, noch stärker als bei ihren Migräneattacken, wie sie berichtet. Im MRT des Kopfes sind Läsionen mit Narbenbildungen zu sehen, die sich über beide Hirnhemisphären erstrecken und die weiße Substanz involvieren, die Läsionen stehen in Verbindung mit Mikroblutungen.
Eine Lumbalpunktion offenbart abnormal hohe Proteinkonzentrationen im Liquor. In Zusammenschau mit der akuten Myokarditis gehen die brasilianischen Ärzte von einer systemischen Vaskulitis mit Beteiligung des zentralen Nervensystems aus.
Biopsie klärt die Myokarditis
Beck-da-Silva und Kollegen entscheiden sich daraufhin, eine Endomyokardbiopsie vorzunehmen. Das Ergebnis der Histologie bringt sie zur finalen Diagnose: Der Befund zeigt eine nekrotisierende eosinophile Myokarditis.
Sofort beginnen die Mediziner eine Stoßtherapie mit Methylprednisolon (1 g täglich i.v. für 5 Tage). Bereits am ersten Tag der Behandlung verbessern sich die Beschwerden der Frau. In den folgenden Tagen normalisieren sich ihre Troponin- und BNP-Werte, die Eosinophilie ist verschwunden und die Ödem- und Fibroseareale im MRT sind deutlich zurückgegangen.
Die Patientin wird ohne Herzinsuffizienz-Beschwerden und mit einer normalen linksventrikulären Funktion entlassen. Die Prednison-Therapie wird nach Abschluss der Stoßtherapie mit 1 mg/kg/Tag für weitere zwei Monate fortgeführt. Bei einem Kontrolltermin nach 20 Tagen haben sich die Vaskulitis-Anzeichen im Hirn-MRT zurückgebildet, das Kardio-MRT nach vier Monaten zeigt nur noch minimale apikale Fibroseareale, sonst keine Auffälligkeiten. 20 Monate später geht es der Frau weiterhin gut, ohne Anzeichen einer Herzinsuffizienz, Migräneattacken hat sie inzwischen keine mehr.
Ungewöhnlicher Auslöser
Doch eine Frage bleibt: Was war die Ursache für die akute Myokarditis? Da die Tryptase-Konzentrationen der Frau normal waren, hatten die brasilianischen Ärzte das Vorhandensein einer monoklonalen myeloproliferativen Erkrankung zu Beginn bereits weitestgehend ausgeschlossen.
Das Labor gab auch keine Hinweise auf eine Autoimmunerkrankung. Die Kardiologen vermuten stattdessen eine exogene Substanz als kausale Ursache. Für gewöhnlich trete eine akute nekrotisierende eosinophile Myokarditis als schwere Komplikation eines arzneimittelbedingten Hautausschlages mit Eosinophilie und systemischer Reaktion – Drug Rash genannt – auf, erläutern sie ihre Gedankengänge.
Das einzige, was die junge Frau zu sich genommen hatte, war ein Migräne-Medikament mit einer Fixkombination aus Isometheptenmucat 30 mg, Metamizol-Natrium 300 mg und Koffein 30 mg. In Brasilien ist dieses Medikament rezeptfrei erhältlich. Die Patientin hatte es in sehr hohen Dosen eingenommen, bis zu sechs Tabletten am Tag über circa drei Wochen hinweg.
OTC-Präparat unter Verdacht
Als auslösende Substanz in Verdacht haben die Ärzte Isometheptenmucat. Dabei handelt es sich um ein Sympathomimetikum, dessen Wirkmechanismus auf einer Vasokonstriktion basiert. Wie die Ärzte berichten, kann die Substanz bei extensiven Gebrauch schwere Nebenwirkungen verursachen, dazu gehören Kopfschmerzen, intrazerebrale Hämorrhagien und Vasospasmen.
Die FDA hat deshalb 2017 die Hersteller dazu aufgerufen, die Verbreitung nicht zugelassener Medikamente, die Isometheptenmucat enthalten, zu stoppen. Im Jahr 2018 haben alle US-Firmen dem Verbot zugestimmt. In Brasilien seien solche Produkte allerdings immer noch rezeptfrei erhältlich, informieren Beck-da-Silva und Kollegen.
In dem Fall der 29-jährigen Patientin halten die Kardiologen es für wahrscheinlich, dass die exzessive Einnahme dieser Substanz eine nekrotisierende eosinophile Myokarditis ausgelöst hat. Das sei der erste Fall, in welchen über diesen Auslöser berichtet wurde, erläutern sie die Besonderheit. Entscheidend für die finale Diagnosestellung war ihre Ansicht nach die Lumbarpunktion zur Feststellung der ZNS-Beteiligung und die dringlich veranlasste Endomyokardbiopsie.
Mehr Informationen zur Kardiologie unter www.springermedizin.de