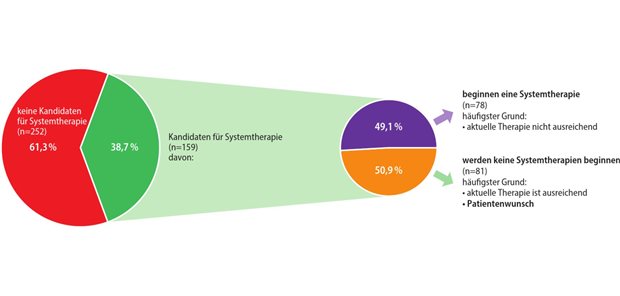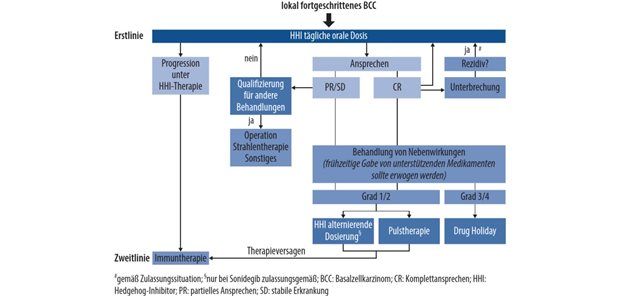Alopezia areata
Haarfollikel als Depot für Arzneimittel
Nanopartikel könnten dabei helfen, die Therapie bei Alopezia areata zu verbessern.
Veröffentlicht:Saarbrücken. Dass sich Medikamente über die Haut verabreichen lassen, ist bereits bekannt: In biologisch abbaubare Nanopartikel verpackt, können sie über die Haarfollikel in den Körper eingeschleust werden.
Forscher haben nun demonstriert, dass dieser Mechanismus auch bei den Kopfhaaren des Menschen funktioniert – und das sogar bei Patienten, die an Alopezia areata leiden, berichtet die Uni des Saarlandes. Das könnte die Wirksamkeit einer lokalen Behandlung zukünftig verbessern.
Entzündlich bedingter Haarausfall
Alopezia Areata ist bekanntlich ein entzündlich bedingter, reversibler Haarausfall, bei dem kreisrunde kahle Stellen auf dem Kopf entstehen. Rund zwei Prozent der Weltbevölkerung sind von der Erkrankung betroffen. Medikamente zur Behandlung bei Alopezia Areata werden bisher entweder in Tablettenform verabreicht oder großflächig auf der Kopfhaut angewendet. Dabei handelt es sich etwa um Cortison-Präparate, die ja starke Nebenwirkungen hervorrufen können.
„Um die Arzneimittelbelastung zu minimieren, wäre es von Vorteil, die Wirkstoffe direkt an ihren Wirkort, nämlich in die Haarfollikel, zu bringen“, wird Studienleiter Professor Claus-Michael Lehr, in der Mitteilung der Universität des Saarlandes zitiert.
Seine Idee ist es, eine solche gezielte „Anlieferung“ mithilfe von biologisch abbaubaren Nanopartikeln zu ermöglichen; diese würden gleichermaßen als Verpackung und Transportvehikel für die Wirkstoffe dienen. Auf diese Weise könnten möglichst viele Wirkstoffe in die Haarfollikel eindringen.
In früheren Studien hatten Professor Claus-Michael Lehr und sein Team demonstriert, dass es grundsätzlich möglich ist, Wirkstoffe mithilfe von Nanopartikeln einzuschleusen – bisher allerdings nur an behaarter Haut, nämlich am menschlichen Unterarm sowie im Laborexperiment an der Haut von Schweineohren. Für den Kopf war der Mechanismus nicht nachgewiesen worden. „Darüber hinaus haben wir uns gefragt, ob Nanopartikel überhaupt in Haarfollikel eindringen können, die vom Haarausfall betroffen sind“, sagt Lehr.
Für ihre aktuelle Studie bezogen die Forscher daher unterschiedliche Gruppen ein: gesunde Probanden, kürzlich gestorbene Körperspender sowie Patienten mit Alopezia areata (J Invest Dermatol 2019; online 2. Juli).
Wirkstoffdepot im Haarfollikel
Als Nanopartikel wurden biologisch abbaubare, bio-kompatible Polymere genutzt, die mit einem fluoreszierenden Farbstoff markiert wurden. „Wir konnten zeigen, dass das, was für Unterarme und die Haut des Schweineohrs gilt, auch für das Haupthaar zutrifft – selbst dann, wenn das Haar erkrankt ist und der Haarschaft nicht mehr vorhanden ist“, fasst Lehr die Ergebnisse in der Mitteilung zusammen.
Mittels dermatologischer Untersuchungen, bei denen die Haut mikroskopisch bis in tiefere Schichten untersucht wird, fanden die Forscher heraus, dass im Haarfollikel ein Wirkstoffdepot angelegt wird, in dem das verkapselte Medikament gut gegen äußere Einflüsse wie Waschen geschützt ist.
„Die Nanopartikel lagern sich im oberen Teil der Haarfollikel ab. Wir nehmen an, dass sie das Medikament kontrolliert freisetzen, dass es von dort an den Grund des Haarfollikels diffundiert und von den follikulären Epithelzellen und Immunzellen aufgenommen wird“, wird Professor Thomas Vogt, ebenfalls an der Studie beteiligt, in der Mitteilung zitiert.
Im nächsten Schritt wollen die Forscher die Partikel mit Wirkstoffen beladen, da in der aktuellen Arbeit lediglich „Dummys“ benutzt wurden. Dabei solle es darum gehen, den nackten Wirkstoff und das Nano-Medikament miteinander zu vergleichen, so Lehr. (eb)