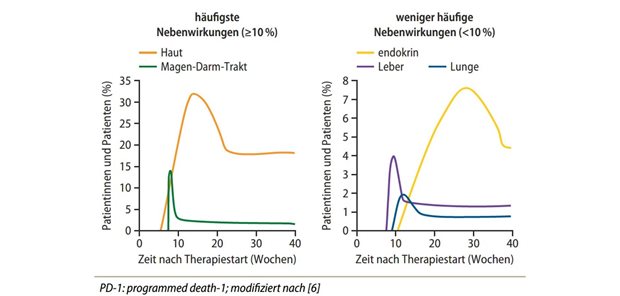Biophysik
Immunzellen auf der Jagd nach Krankheitserregern
Dendritische Zellen durchstöbern die Haut nach Keimen. Sie können dabei rasch herumflitzen oder einzelne Bereiche genauer unter die Lupe nehmen.
Veröffentlicht: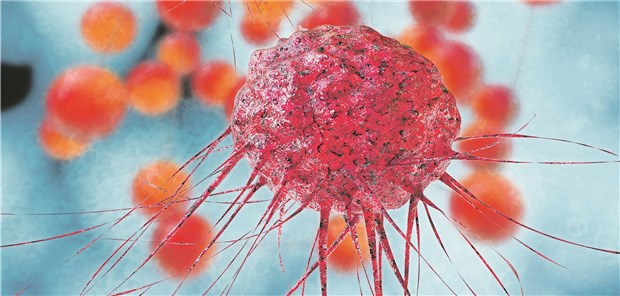
Dendritische Zellen (groß) auf der Patrouille.
© fotoliaxrender / Fotolia
Saarbrücken. Immunzellen sind ständig unterwegs, um Krankheitserreger abzufangen. In den oberen Hautschichten sind dies insbesondere dendritische Zellen, die sich etwa um das Zehn- bis 15-fache schneller als andere Körperzellen durch die Zellschichten bewegen.
Wie die Zellen dies genau bewerkstelligen, war bisher unklar. Biophysiker um Professorin Franziska Lautenschläger, Nachwuchsgruppenleiterin des Leibniz-Instituts für Neue Materialien, haben nun herausgefunden, wie die Fortbewegung der Abwehrzellen funktioniert (PNAS 2019; online 27. Dezember).
Amöboide Migration
„Dendritische Zellen nutzen die so genannte amöboide Migration, die wenig erforscht ist“, so die Wissenschaftlerin in einer Mitteilung der Universität des Saarlandes zur Veröffentlichung der Studie. Dabei stülpe sich die Zelle wie eine Amöbe so aus, dass sie jede beliebige Form annehmen kann und so auch in jeden denkbaren Zwischenraum passt.
„Dabei bewegen sich die Zellen nach zwei Mustern: Entweder recht geradlinig in langen, gebogenen Kurven – persistent – oder diffus“, erklärt Lautenschläger. Vereinfacht bedeutet dies, dass die Zellen entweder große Distanzen recht schnell überwinden, dabei aber nicht wirklich gründlich suchen (persistent). Oder sie suchen diffus nur einen recht kleinen Radius durch, diesen aber sehr gründlich.
Am besten ist ein Mix
Ein bestimmter Mix aus beiden Bewegungen ist dabei die ideale Kombination, um schnell und gründlich Krankheitserreger aufzuspüren. Es gibt also einen gewissen Anteil an Zellen, die gründlich auf kleinem Raum suchen, und einen weiteren Teil, der für die Suche schnell von A nach B eilt, heißt es in der Mitteilung.
Dabei könnten die Zellen sehr schnell von einer in die andere Bewegungsart umschalten, indem sie das Protein Aktin in den Zellen zu einer langen Kette, einem Polymer, zusammenschließen. Ist diese Aktin-Spirale irgendwann lang genug, stoße sie an die Zellwand, stülpe diese aus und gebe der Zelle damit einen „Schubs“ oder Impuls in eine bestimmte Richtung, so die Uni in ihrer Mitteilung.
„Je schneller diese Polymerisation von Aktin dabei vonstatten geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Zelle persistent, also eher schnell geradeaus, fortbewegt“, erklärt Lautenschläger. Bilden sich die Aktin-Wellen langsamer, bewegt sich die Zelle eher diffus, also kleinräumig.
Prozess im menschlichen Körper entschlüsselt
Das Forscherteam hat damit eine weitere Frage aus der biophysikalischen Grundlagenforschung beantwortet, die die Prozesse im menschlichen Körper entschlüsseln möchte.
Ob diese Erkenntnis irgendwann einen praktischen Nutzen entfalten wird, ist noch völlig unklar. „Aber wenn wir verstehen wollen, wie Krankheiten funktionieren und auch, wie das Immunsystem auf bestimmte Bedrohungen reagiert, müssen wir solche Grundlagen verstehen“, resümiert Lautenschläger. (eb)