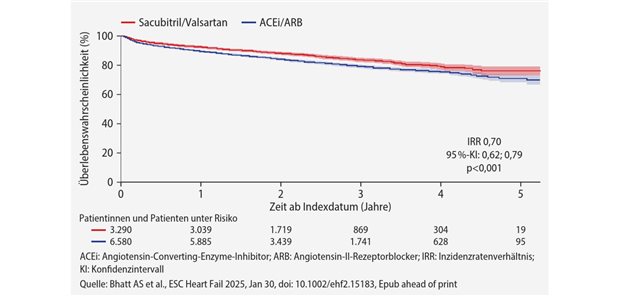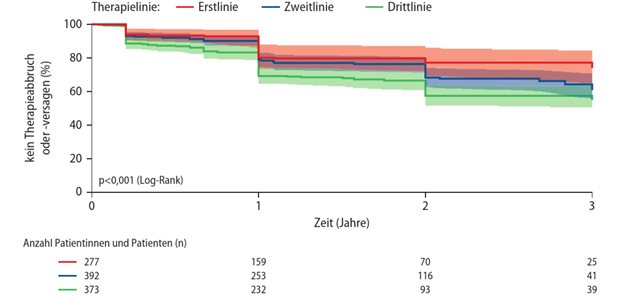Aktueller Sachstandsbericht
Klimawandel: Krankheitserreger können sich in Deutschland besser ausbreiten
Ein aktueller Sachstandsbericht, der unter Federführung des Robert Koch-Instituts (RKI) entstanden ist, gibt einen Überblick zu den gesundheitlichen Folgen durch den Klimawandel und Möglichkeiten, ihnen entgegenzutreten.
Veröffentlicht:
Tigermücken können nicht nur Zika-Infektionen verursachen, sondern auch Dengue- und Chikungunya-Viren übertragen. Die Mücken verbreiten sich mittlerweile auch in verschiedenen Gebieten Deutschlands aus.
© Stephan Jansen / dpa
Berlin. Mehr Hitzetote, neue und vermehrt auftretende Infektionskrankheiten, erhöhte Allergiebelastung, Zunahme von Antibiotikaresistenzen, mehr Lungenerkrankungen als Folge zunehmender Feinstaubbelastung, mehr Hautkrebs durch erhöhte UV-Strahlung – das sind einige der negativen Folgen des Klimawandels für die Gesundheit der Bevölkerung.
Ein neuer Bericht, der unter Federführung des Robert Koch-Instituts (RKI) entstanden ist, gibt einen Überblick zu den gesundheitlichen Folgen durch den Klimawandel und Möglichkeiten, ihnen entgegenzutreten. Die Koordination der Publikation erfolgt im Rahmen des Projekts „KlimGesundAkt“, das durch das Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird, teilt das RKI mit.
Über 90 Autorinnen und Autoren aus über 30 Forschungseinrichtungen und Behörden
„Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die Menschheit, er bedroht unsere Lebensgrundlage und somit unsere sichere Zukunft“, so beginnen die Leiterinnen und Leiter von Behörden in Deutschland, die an Public-Health-Themen arbeiten, ihr Editorial zum neuen Bericht.
Die Editorial-Autoren kommen aus elf Einrichtungen: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Bundesamt für Naturschutz, Bundesamt für Strahlenschutz, Bundesinstitut für Risikobewertung, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Deutscher Wetterdienst, Friedrich-Loeffler-Institut, Thünen-Institut, Umweltbundesamt sowie RKI.
Insgesamt gibt es mehr als 90 Autorinnen und Autoren aus über 30 Forschungseinrichtungen und Behörden. Der Bericht erscheint als Beitragsreihe in drei Ausgaben des Journal of Health Monitoring, der erste Teil am 1.6. in der Ausgabe S3/2023.
Einfluss des Klimawandels auf Infektionskrankheiten
Schwerpunkt der ersten Ausgabe ist der Einfluss des Klimawandels auf Infektionskrankheiten. Themen sind Vektor- und Nagetier-assoziierte Infektionen, wasserbürtige Infektionen und Intoxikationen, lebensmittelassoziierte Infektionen und Intoxikationen sowie Antibiotikaresistenzen. Ein einleitender Beitrag umreißt das gesamte im Sachstandsbericht behandelte Themenfeld Klimawandel und Gesundheit.
Weil Zecken und Mücken, Bakterien und Viren wegen des Klimawandels zunehmend für sie günstige Bedingungen vorfinden, müssen die Bundesbürger sich auf eine stärkere Verbreitung von Infektionskrankheiten einstellen. Durch zunehmende Temperaturen könnten sich Krankheitserreger wie Bakterien, Salmonellen, Legionellen oder Hanta-Viren oder deren Überträger wie Mücken und Zecken besser in Deutschland ausbreiten, heißt es in dem aktuellen Sachstandsbericht.
Vorboten bereits zu beobachten
Schon jetzt seien Vorboten zu beobachten, betonen die Autoren. So wurden 2019 in Deutschland die ersten Fälle von West-Nil-Fieber bei Menschen bekannt, die sich nicht auf Reisen im Ausland, sondern durch den Stich heimischer Mücken angesteckt hatten.
In Südfrankreich wurden erstmals Zika-Infektionen durch Tigermücken gemeldet, die dort heimisch sind. Sie können auch Dengue- und Chikungunya-Viren übertragen. Die Tigermücken verbreiten sich in verschiedenen Gebieten Deutschlands. Auch Zecken, die etwa Meningitis und Borreliose übertragen, dringen in immer mehr Regionen vor.
Der Bericht verweist auf weitere mögliche Risiken für die Gesundheit. So trage der Anstieg der Meeresoberflächentemperaturen in Nord- und Ostsee zu einer Vermehrung von Vibrionen bei. Diese Bakterien lösten vor allem Wundinfektionen und Durchfallerkrankungen aus. Auch das Risiko von Lebensmittelvergiftungen wachse: So könnten vermehrt Magen-Darm-Infektionen durch Salmonellen oder Campylobacter entstehen, betont die Studie. Die höheren Temperaturen könnten zudem zu vermehrten Resistenzen gegen Antibiotika beitragen. Auch die von Mäusen übertragenen Hanta-Viren könnten sich ausbreiten.
Senioren und Kinder besonders gefährdet
Die Augsburger Medizinerin Professor Elke Hertig, Mitautorin des Berichts, erklärte im Vorfeld, mehr Klimaschutz bedeute auch mehr Gesundheitsschutz. Wie sie warnte auch Professor Klaus Stark, Mitautor und RKI-Experte für tropische Infektionen, jedoch vor Panik: Die große Mehrheit der Infektionen etwa mit dem West-Nil-Virus verlaufe ohne Symptome und werde deshalb gar nicht erkannt. Die Ausbreitung verlaufe zudem langsam und regional sehr unterschiedlich.
Die Studie betont, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen von den Risiken sehr unterschiedlich betroffen sein werden. Insbesondere ältere oder durch Vorerkrankungen geschwächte Personen seien besonders betroffen. Auch Kinder seien den klimabedingten Gesundheitsrisiken stark ausgesetzt. Ihr Körper reagiere empfindlicher auf Krankheiten und Schadstoffe.
Zweite Ausgabe fokussiert auf nicht-übertragbare Erkrankungen
Die zweite Ausgabe des aktuellen Sachstandsberichtberichts fokussiert laut RKI im 3. Quartal auf nicht-übertragbare Erkrankungen, die etwa durch Hitze und andere Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen vermittelt werden können, auf den Einfluss des Klimawandels auf allergische Erkrankungen, die Folgen veränderter UV-Strahlung oder höherer Luftschadstoffbelastungen sowie die Folgen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit.
Die dritte Ausgabe, die im 4. Quartal erscheint, untersucht die gesundheitliche Chancengleichheit im Hinblick auf Auswirkungen des Klimawandels, die Bedeutung der zielgruppenspezifischen Klimawandelkommunikation und formuliert den Handlungsbedarf auf Basis der in den anderen Beiträgen formulierten Handlungsempfehlungen.
Themenspezifische Handlungsempfehlungen weisen auf hohen Forschungsbedarf hin
„Neben verschiedenen themenspezifischen Handlungsempfehlungen haben alle Beiträge eines gemeinsam: Sie weisen auf einen anhaltend hohen Forschungsbedarf hin. Auch erweitertes Monitoring vieler gesundheitlicher Auswirkungen des Klimawandels wird empfohlen“, so das Resümee der Editorial-Autorinnen und Autoren.
Der Klimawandel betrifft viele weitere Handlungsfelder, die mit gesundheitsbezogenen Aspekten zusammenhängen, z. B. das Bauwesen oder die Stadt- und Raumentwicklung. „Daher erfordern gesundheitssensibler Klimaschutz und Klimawandelanpassung eine intersektorale Zusammenarbeit und den Austausch verschiedener Akteurinnen und Akteure im Sinne von One Health und Health in All Policies“, betonen die Autorinnen und Autoren des Editorials und haben dazu passend die Überschrift formuliert: „Gemeinsam können wir den Auswirkungen des Klimawandels begegnen“. (ikr/KNA)