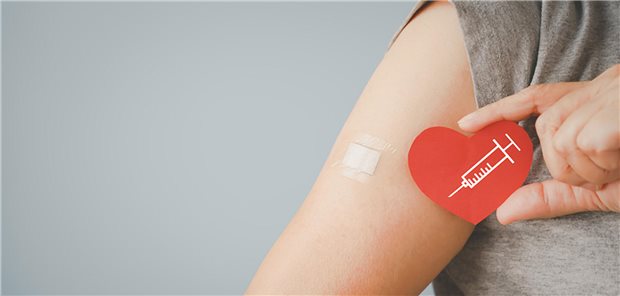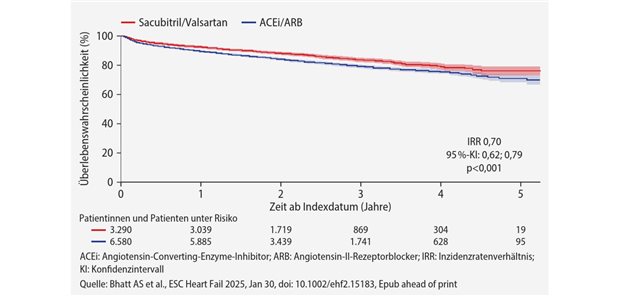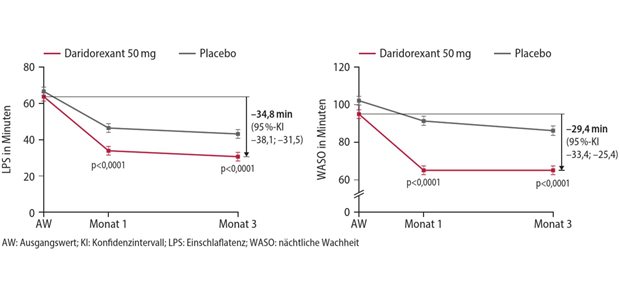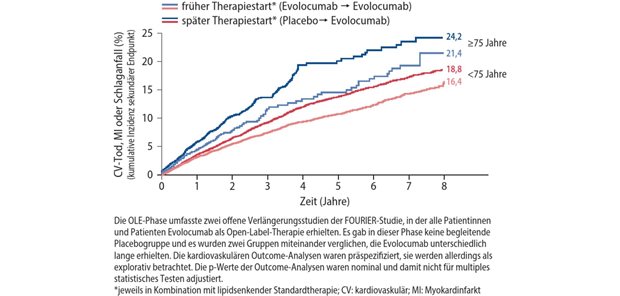EPIC-Studie
Vegetarier haben weniger Infarkte, jedoch mehr Insulte
Vegetarier und Veganer essen aus kardiologischer Sicht durchaus gesünder. Der neurologische Blick ins Gehirn zeigt jedoch auch mögliche Nachteile. Die kann man aber durch eine Maßnahme umgehen.
Veröffentlicht:
Vegetarische Kost: Schadet die erniedrigte Zufuhr bestimmter Nährstoffe den Hirngefäßen?
© Barbara Pheby/stock.adobe.com
Neue Daten aus der EPIC-Studie
- Vegetarier, nicht aber Fischesser, haben ein um 20 Prozent höheres Risiko für Schlaganfälle als Fleischesser.
- Das erhöhte Insultrisiko ist wesentlich bedingt durch die um 43 Prozent erhöhte Rate hämorrhagischer Insulte.
Oxford. Eine vegetarische Ernährung, die vegane Variante eingeschlossen, senkt das Risiko, eine ischämische Herzerkrankung zu entwickeln. Auch wer auf Fleisch verzichtet, aber Fisch verzehrt, hat diesbezüglich Vorteile. Insgesamt betrachtet schneiden Braten- und Wurstabstinenzler in puncto kardiovaskulärer Gesundheit besser ab. Doch es lohnt sich, den Blick aufs Detail zu heften.
Denn laut neuen Ergebnissen der European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Studie, die auf den 18-Jahres-Nachbeobachtungsdaten von mehr als 48 000 Probanden beruhen, hat eine fleischlose Kost – die rund die Hälfte der Studienteilnehmer bevorzugten – womöglich auch gesundheitliche Nachteile.
Neue Daten der EPIC-Studie
Wie die EPIC-Forscher um Dr. Tammy Tong von der Universität Oxford nach Abgleich sozioökonomischer und lebensstilbedingter Einflussfaktoren ausgerechnet haben, weisen Fischesser ein um 13 Prozent und Vegetarier ein um 22 Prozent niedrigeres Risiko als Fleischesser auf, eine ischämische Herzkrankheit zu entwickeln (BMJ 2019; 366: l4897).
Je 1000 Personen wirkt sich das für Vegetarier in einem Minus von zehn Fällen in zehn Jahren aus. Bezieht man Angaben zu Hypercholesterinämie, Bluthochdruck, Diabetes und BMI in die Kalkulationen ein, schwächt sich die Assoziation ab. Das ist allerdings auch zu erwarten, weil ein allfälliger kardioprotektiver Effekt fleischloser Ernährung vermutlich genau dadurch zustande kommt, dass diese sich günstig auf Lipidprofil, Blutdruck, Blutglukose und BMI auswirkt.
Andererseits haben Vegetarier, nicht aber Fischesser, ein um 20 Prozent höheres Risiko für Schlaganfälle. Dies ist wesentlich bedingt durch die um 43 Prozent erhöhte Rate hämorrhagischer Insulte. Für den ischämischen Hirninfarkt, wie übrigens auch für den akuten Myokardinfarkt, waren keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ernährungsgruppen festzustellen. Im Gegensatz zur Situation bei der ischämischen Herzkrankheit gab es nach Einbezug von Einflussgrößen nur geringe Veränderungen in den Assoziationen – eine Rolle spielte am ehesten der Blutdruck, und zwar eine verstärkende. Auf 1000 Personen und zehn Jahre hochgerechnet, ereigneten sich unter den Studienteilnehmern mit vegetarischer Ernährung drei zusätzliche Schlaganfälle.
Mehr hämorrhagische Insulte
Das Resultat der EPIC-Studie mit Blick auf Insulte geht konform mit Erkenntnissen aus anderen Studien, wonach das Risiko für hämorrhagische Schlaganfälle je Reduktion des LDL-Cholesterins um 1 mmol/l (39 mg/dl) um 21 Prozent steigt. Tong und Kollegen verweisen außerdem darauf, dass die Konzentrationen von Vitamin B12, Vitamin D, essenziellen Aminosäuren und langkettigen, mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren im Blut der Vegetarier geringer waren als bei den Fleischessern.
Zwei Indizien sprechen dafür, dass das höhere Insultrisiko von Vegetariern mit einer erniedrigten Zufuhr bestimmter Nährstoffe zusammenhängen könnte. Zum einen fiel die Erhöhung des Insultrisikos (wie auch die Erniedrigung des Risikos für ischämische Herzkrankheit) bei Veganern deutlicher aus als bei Vegetariern. Zum andern verstärkte der Abgleich nach einer bestehenden Hypertonie den Zusammenhang sogar. Wäre der Blutdruck der allein verantwortliche Faktor – und als Hauptrisikofaktor für zerebrale Insulte ist die Hypertonie etabliert –, hätte sich die Assoziation eigentlich abschwächen müssen.
In der Summe zahlt sich eine fleischlose Ernährung in kardiovaskulärer Hinsicht aus, das erhöhte Insultrisiko ist aber zu beachten. Einschränkend ist festzustellen: Die Angaben zur Ernährung beruhten auf Selbstauskünften der Probanden, und die Gründe für die Wahl der Ernährungsweise waren unbekannt. Außerdem: Ein im Follow-up unbemerkter Wechsel der Ernährungsgruppe war nicht ausgeschlossen.