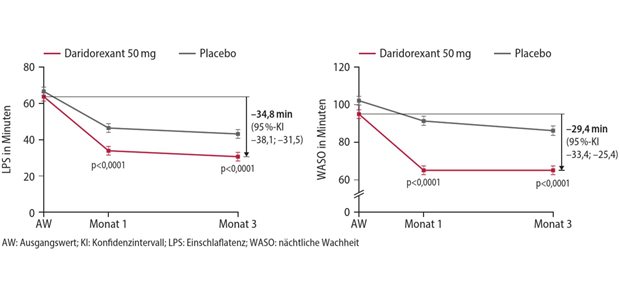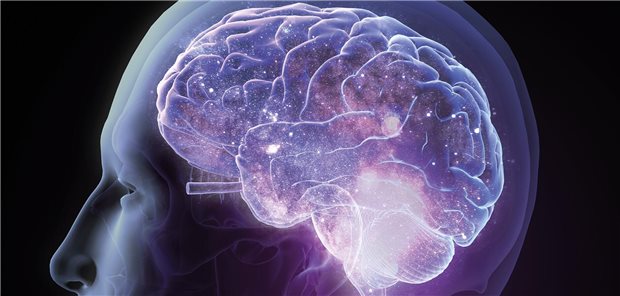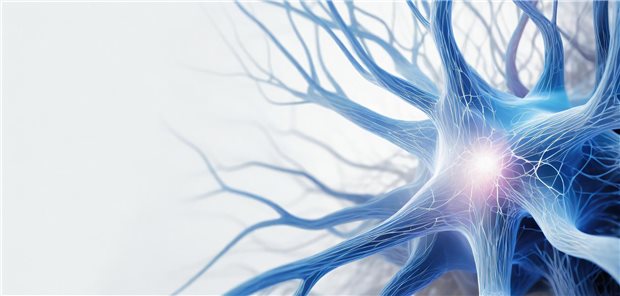Palliativversorgung
Eine Taskforce für Demenz-Patienten
Wenn Demenz-Patienten palliativmedizinische Hilfe benötigen, stellt das Ärzte, Pflegekräfte und Angehörige vor große Probleme. Eine Taskforce aus Palliativmedizinern, Psychiatern und Nervenärzten sucht nach Lösungen.
Veröffentlicht:
Damit Demenzpatienten gut versorgt werden, ist psychiatrische und palliativmedizinische Expertise erforderlich.
© Britta Pedersen / dpa
Berlin. Die Einrichtung einer Taskforce signalisiert: Es besteht Handlungsbedarf. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde sowie die Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie haben eine solche Spezial-Arbeitsgruppe eingerichtet, um die Schnittstellen zwischen ihren beiden Fachgebieten zu beleuchten und Ansätze zur Verbesserung der Versorgung von Patienten mit psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen in der letzten Lebensphase zu verbessern.
„In der Palliativmedizin sind die onkologischen Patienten nach wie vor das Hauptthema“, sagt DGP-Vizepräsident Urs Münch, Mitglied der Taskforce. „Wir haben die Situation, dass in der Palliativversorgung selbst das Wissen um psychiatrische Erkrankungen und den Umgang mit den Erkrankten nicht sehr ausgeprägt ist“, berichtet der psychologische Psychotherapeut und Psychoonkologe, der am Viszeralonkologischen Zentrum der DRK Kliniken Berlin Westend tätig ist.
Gleichzeitig haben viele Neurologen und Psychiater kaum Berührungspunkte mit der Palliativmedizin und kennen sich mit dem Thema nicht gut aus. Eine Ausnahme seien die Gerontopsychiater, sagt Münch. Sie sind aber vor allem in stationären Einrichtungen tätig, niedergelassene Gerontopsychiater gibt es kaum.
„Noch ganz viel Luft nach oben“
In den vergangenen Jahren hat sich in diesem Bereich zwar schon einiges getan. „Es gibt aber immer noch ganz viel Luft nach oben“, betont Münch. So komme es immer wieder vor, dass Palliativteams psychiatrische Patienten nicht aufnehmen, weil sie diesen Versorgungsbereich nicht abdecken können.
„Das Thema gehört schon in die Ausbildung, sowohl im Medizinstudium als auch in der Psychotherapeuten-Ausbildung“, findet er. Es gebe zwar schon Ansätze, gerade bei den Psychotherapeuten. „Aber das ist noch ausbaufähig.“
Die Arbeit der Taskforce richtet sich vor allem auf vier Patientengruppen: schwerst somatisch Erkrankte mit psychischer Erkrankung/Symptomatik am Lebensende, schwerst psychisch Erkrankte mit dazukommender schwerer, unheilbarer somatischer Erkrankung und als Fokus schwerst und progredient psychisch Erkrankte mit Therapieresistenz.
Zunächst einmal zurückgestellt haben die Mitglieder das Thema Patienten im Maßregelvollzug. „Es geht darum, Schnittstellen von Palliativmedizinern und Psychiatern zu finden, gemeinsame Ziele zu definieren und gegenseitig den Horizont zu erweitern“, erläutert Münch.
Gegenseitige Unterstützung

Der richtige Umgang mit Demenzpatienten stellt Angehörige und Ärzte häufig vor große Probleme.
© Ocskay Bence / stock.adobe.com
Palliativmedizin und Psychiatrie können sich gegenseitig auf wertvolle Art ergänzen, sagt auch Dr. Klaus Maria Perrar, Personaloberarzt des Zentrums für Palliativmedizin an der Universitätsklinik Köln und Mitglied der Taskforce. Perrar ist Psychiater, Psychotherapeut und Palliativmediziner. Ein Beispiel: „Psychiater können die Palliativmediziner dabei unterstützen, mit dem psychischen Anderssein kompetent umzugehen.“
Grundsätzlich haben die beiden Disziplinen ähnliche Herangehensweisen, sie verbindet das multiprofessionelle Arbeiten und die systemische Denkweise, sagt er. Klar ist für Perrar: „Es bedarf der Expertise aus beiden Bereichen.“ Deshalb die Taskforce.
Die zahlenmäßig größte Patientengruppe, die von einem Zusammenwirken von Palliativmedizinern und Psychiatern profitieren können, sind Demenzkranke. „Geriatrisch multimorbide Patienten mit kognitiven Einschränkungen werden noch immer ungenügend versorgt.
Da muss sich noch sehr viel verändern“, stellt Dr. Elisabeth Jentschke fest, Leiterin der Abteilung Neuropsychologie an der Universitätsklinik Würzburg. „Wir müssen viel mehr hinschauen.“
Ein großes Problem liegt nach ihrer Erfahrung darin, dass die Demenz bei vielen Patienten nicht oder zu spät diagnostiziert wird. „Wir sehen auch auf der Palliativstation Patienten, bei denen nie im Vorfeld eine solche Diagnose gestellt wurde“, berichtet sie. Dabei lasse sich bei Demenz durch begleitende Verfahren der Verlauf positiv beeinflussen.
Mehr Kompetenz durch Schulung und Weiterbildung
Wichtig sei die Differentialdiagnostik. „Bei Patienten auf der Palliativstation benötige ich Wissen über die Demenzform und die dazugehörigen Ausdrucks- und Verhaltensweisen“, erläutert Jentschke, die ebenfalls in der Taskforce mitarbeitet.
Über Schulungen und Weiterbildungen müssten die Mitarbeiter in Heimen und Krankenhäusern hinsichtlich der Handlungskompetenzen gestärkt werden, fordert sie. Den Pflegenden müsse bewusst sein, dass Verhaltensauffälligkeiten bei Demenz ein Ausdruck des Krankheitsbildes sind. So könne sich bei frontotemporaler Demenz Distanzlosigkeit gegenüber dem Pflegepersonal zeigen.
Schulungen brauchen die Mitarbeiter nicht nur auf Palliativstationen, um erkennen zu können, ob ein Demenzkranker Schmerzen hat. Denn ein nicht erkannter Schmerz kann auch Ursache für ein auffälliges Verhalten sein. Bei Fortbildungen zeigt sich häufig, dass nicht einmal die Hälfte der Teilnehmer ein Instrumentarium zur Schmerzerkennung parat hat, berichtet Jentschke.
Lebensqualität erhalten und Würde stärken
„Wir müssen die Patienten mit Demenz so versorgen, dass wir die Lebensqualität erhalten und die Würde stärken“, betont sie. Die Realität sehe aber anders aus. Ein Problem aus ihrer Sicht: „Es fehlen die Haltung und die Einstellung, dass die Menschen mit Demenz einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.“
Bei Demenzpatienten gehe es oft nicht nur ums Sprechen. Stattdessen sei es sinnvoll, mit Emotionen und den verbliebenen Erinnerungen der Menschen zu arbeiten. Hilfreich seien deshalb Angebote wie die basale Stimulation, biografisches Arbeiten, Selbsterhaltungstherapie, ein validierender Kommunikationsstil und der Einsatz einer Musiktherapie.
„Ich muss Gestik und Mimik beobachten, dann kann ich sehen, was dem Patienten gut tut“, erläutert die Gerontologin.
Bei allen Defiziten: In den vergangenen Jahren hat sich schon viel getan, betont Jentschke. In den Einrichtungen gebe es inzwischen mehr Mitarbeiter, die sich mit dem Thema Demenz auskennen. „Aber wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen, gerade angesichts der Demografie“, sagt sie.
Stationäre Pflegeeinrichtungen müssen sich viel besser auf die Versorgung von Bewohnern mit einer fortgeschrittenen Demenz einstellen.
Das gilt insbesondere für die Betreuung in der letzten Lebensphase. Sowohl bei der Qualifizierung von Mitarbeitern als auch bei der Zusammenarbeit mit Ärzten gibt es noch Luft nach oben, weiß Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.
„Die Heime müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie mit dieser vulnerablen Gruppe umgehen, und ein gutes Konzept entwickeln.“
Pflegekräfte brauchen mehr Zeit
Dazu gehört aus ihrer Sicht ausreichend Personal, das gut ausgebildet ist. „Die Heime sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter speziell für die Begleitung von Demenzkranken qualifizieren, denn es braucht ein spezielles Wissen“, sagt Schneider-Schelte, die das Alzheimer-Telefon der Gesellschaft leitet. Palliatives Wissen ohne Wissen um Demenz reiche nicht aus.
„Bei Menschen mit Demenz ist es wichtig, auf nonverbale Zeichen zu achten, auf die Mimik, auf den Gesichtsausdruck. Menschen mit Demenz können nicht ausdrücken, dass sie Schmerzen haben oder sich unwohl fühlen.“
Die Begleiter müssten lernen, auch ohne Sprache zu kommunizieren und die häufig gefühlsmäßigen Reaktionen der Bewohner zu verstehen.
Zeitintensive Betreuung
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Zeit. Die Pflegenden brauchen für die Versorgung der Demenzkranken oft länger als bei anderen Bewohnern. „Wenn jemand noch selbstständig essen kann, muss man ihm das Essen immer wieder anbieten“, erläutert sie. In den Heimen lasse sich das oft kaum umsetzen.
„Sich die Zeit nehmen, die der Mensch braucht, bedeutet aber Lebensqualität.“ Schneider-Schelte würde es begrüßen, wenn alle Heime mit Palliativmedizinern, Palliativteams oder speziell ausgebildeten Palliativfachkräften zusammenarbeiten würden.
„Dann gewinnen die Pflegekräfte an Sicherheit.“ Auf diesem Weg ließen sich auch die häufigen Krankenhauseinweisungen von Menschen mit fortgeschrittener Demenz vermeiden. „Eigentlich will keiner, dass die Demenzkranken ins Krankenhaus kommen, aber bei einer Krise tritt häufig große Verunsicherung auf.“
Angehörige einbeziehen
Ein wichtiger Punkt ist für Schneider-Schelte die Rolle der Angehörigen. „Engagierte Angehörige wünschen es sich sehr, einbezogen zu werden.“ Viele sind Bevollmächtigte und müssen Entscheidungen treffen. Dazu benötigen sie aber Informationen und Hilfestellungen, sagt sie.
Sinnvoll seien Fallbesprechungen über die palliative Versorgung der Demenzkranken. „Angehörige, Ärzte und Pflegekräfte müssen gemeinsam überlegen, was das Beste für den einzelnen Menschen ist.“
Das sieht der Psychiater und Palliativmediziner Dr. Klaus Maria Perrar von der Uniklinik Köln ähnlich. „Ich finde es wichtig, zu den Fallkonferenzen auch die Angehörigen hinzuzuziehen, aber das macht kaum jemand.“
Die stärkere Beteiligung der Angehörigen ist für ihn Teil des notwendigen Ansatzes, die Demenzkranken mit ihren unterschiedlichen Wünschen und Neigungen in den Mittelpunkt der Versorgung zu stellen. „Selbst mit schwerster Demenz haben die Menschen noch recht differenzierte Bedürfnisse.“
Spezielle Handreichung erstellt
Damit die Mitarbeiter in den Heimen diesem Anspruch gerecht werden können, hat Perrar gemeinsam mit Kollegen des Zentrums für Palliativmedizin an der Uniklinik die „Kölner Arbeitshilfe zur bedürfnisorientierten Versorgung von Menschen mit schwerer Demenz“ erstellt:
„Unsere Handreichung basiert auf Forschungsergebnissen, die gezeigt haben, dass der Mensch mit schwerer Demenz weiterhin eine Person mit individuellen Bedürfnissen ist.“ Die palliative Versorgung der Patienten stellt besondere Anforderungen an Ärzte und Pflegekräfte, weiß Perrar.
„Die Kunst besteht darin, sensibel für die Bedürfnisse zu sein, denn die Nicht-Erfüllung ist mit Leid verbunden“, betont er.
Lebensbilanz ziehen? Geht nicht!
Ein zentrales Element der Palliativversorgung, die Auseinandersetzung mit dem Lebensende, sei im Umgang mit Demenzkranken schwierig bis gar nicht umzusetzen, sagt Perrar. „Bei onkologischen Patienten kann man eine Lebensbilanz ziehen, bei Demenzkranken geht das nicht.“
Bei Demenzkranken ist es schwieriger als bei anderen Patienten, die letzte Lebensphase und die Sterbephase zu erkennen. Denn: „Die Sprache ist verändert bis völlig erloschen.“
Wenn die Menschen nicht mehr essen wollen oder essen können, kann das ein Zeichen des bevorstehenden Sterbens sein, erläutert er. Die Ursachen für die schlechte Nahrungsaufnahme müssen abgeklärt werden, das weitere Vorgehen sollte mit den Angehörigen und den Pflegenden besprochen werden.
„Die Kunst der Palliativmediziner ist es, hier die wichtige Frage nach der weiteren Lebensqualität zu stellen.“ (iss)
Bei der psychiatrischen und palliativmedizinischen Versorgung von Menschen mit Demenz gibt es oft keine Schnittstelle, sondern eine Leerstelle. Das betrifft sowohl die Versorgung der Patienten als auch die Forschung, weiß Professorin Janine Diehl-Schmid, Oberärztin an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Zentrum für Kognitive Störungen am Klinikum rechts der Isar in München. „Der Konnex Palliativversorgung/Demenz existiert nicht.“
Diehl-Schmid warnt vor einem Missverständnis: „Demenz im frühen Stadium ist keine Palliativindikation“, sagt die Psychiaterin. „Man tut den Patienten keinen Gefallen, wenn man sie als Palliativ-Patienten sieht, man nimmt ihnen damit die Hoffnung.“
Spezifische Probleme erst in der letzten Erkrankungsphase
Erst in der letzten Phase der Erkrankung – das können einige Monate, aber auch zwei Jahre sein – fangen die spezifischen Probleme an, denn dann müssen die Patienten angemessen palliativ versorgt werden. Diehl-Schmid betreut seit vielen Jahren schwerpunktmäßig Patienten mit einer früh beginnenden Demenz, also vor dem Alter von 65 Jahren.
Ihr habe lange Zeit die Expertise bei Fragen wie der künstlichen Ernährung oder dem Umgang mit epileptischen Anfällen gefehlt, berichtet sie. Deshalb hatte sie Kollegen aus der Palliativmedizin um Rat gefragt. „Wenn es um Demenz ging, wussten sie aber auch nicht weiter.“
Die Palliativversorgung funktioniere manchmal gut, manchmal gar nicht. „Das hängt von den Playern ab.“ Feste Strukturen fehlen. Einen Grund dafür sieht die Ärztin auch in der Tatsache, dass sich Wissenschaft und Forschung bislang kaum mit dem Thema befasst haben.
EPYLOGUE-Studie soll Lücke schließen
Mit ihrer EPYLOGUE-Studie (Issues in Palliative care for people in advanced and terminal stages of Young-Onset and Late-Onset dementia in Germany) will Diehl-Schmid einen Teil der Lücke schließen. Ziel ist die Formulierung von Empfehlungen für eine bessere Palliativversorgung von Demenzpatienten.
In die Untersuchung sind 100 Patienten mit früher und 100 mit später Demenz einbezogen, jeweils in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Patienten werden oder wurden sowohl zu Hause als auch im Heim versorgt, berichtet sie. Die Patienten beziehungsweise die Angehörigen werden alle drei Monate angerufen.
Erhoben werden körperliche, kognitive und psychische Symptome sowie der Einsatz von medikamentösen und nicht-medikamentösen Therapien oder von lebensverlängernden Maßnahmen. „Bei Todesfällen machen wir eine Post- mortem-Erhebung über den Todesprozess.“
Die Patientenrekrutierung ist Ende 2019 abgeschlossen worden. Die Studie wird vom Bundesforschungsministerium gefördert, Projektpartner ist die Deutsche Alzheimer Gesellschaft.
Versorger sollen Angehörige aufklären
Einige interessante Ergebnisse zeichnen sich bereits ab. „In den Monaten vor dem Tod gibt es erstaunlich viele Krankenhauseinweisungen“, berichtet Diehl-Schmid. Die Versorgung der Patienten in der vertrauten Umgebung funktioniere immer dann gut, wenn ein Arzt oder eine Pflegekraft mit Kenntnissen in der Palliativversorgung einbezogen ist.
„Man braucht jemand, der sich auskennt und die Symptome im Endstadium wie die Atemnot entsprechend medikamentös behandeln kann“, erläutert sie. Wichtig sei auch, dass die Versorger die Angehörigen aufklären und sich Zeit für sie nehmen.
Die Untersuchung hat gezeigt, dass in den Heimen viel mit Psychopharmaka gearbeitet wird. „50 Prozent setzen Psychopharmaka ein, 40 Prozent sedierende Mittel“, berichtet die Psychiaterin. Die Medikation werde zum Teil über Monate und Jahre angesetzt und nicht reduziert.
Das hat große Auswirkungen auf die Lebensqualität, zum Beispiel durch die steigende Sturzgefahr. „Hier können relativ einfach Verbesserungen erzielt werden, indem man das Bewusstsein und die Sensibilität erhöht.“
Frühe oder späte Demenz: Kaum Unterschiede bei Patienten
Erstaunt hat die Wissenschaftler, dass es kaum Unterschiede zwischen den Patienten mit früher und mit später Demenz gibt. Die Menschen mit früher Demenz seien zwar fitter und mobiler. „Aber die Verhaltensauffälligkeiten sind ähnlich, sie sind ähnlich sprachlich eingeschränkt“, sagt Diehl-Schmid. Die beiden Gruppen werden nach den Daten identisch versorgt.
Die Wissenschaftler arbeiten mit Skalen zur Messung der Lebensqualität. Dabei sind sie auf die Mithilfe von Angehörigen, Pflegenden und Ärzten angewiesen.
Für alle überraschend sei, dass die Lebensqualität im Durchschnitt gut ist. „Man kann eindeutig sagen: Auch der schwer demente Patient hat eine gewisse Lebensqualität“, betont sie. Das sei eine positive Nachricht. „Es gibt aber auch Menschen, die leiden entsetzlich unter neuro-psychiatrischen Symptomen.“
Individuelle Angebote bei Demenz
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat Empfehlungen zur Begleitung von Menschen mit Demenz in der Sterbephase herausgegeben. Einige der Empfehlungen:
- Auch im Sterbeprozess sollten demnach alle Formen der Kommunikation genutzt werden, dabei gewinnt die nonverbale Kommunikation an Bedeutung, etwa über den Körperkontakt.
- Demenzerkrankte können bis zuletzt über die Sinnesorgane erreicht werden. „Die Angebote sollten individuell angepasst sein, denn die Vorlieben zum Beispiel für Düfte, Musik, Berührung, Farben sind unterschiedlich.“
- Da Menschen mit Demenz ihre Schmerzen oft nicht benennen können, ist eine gute Beobachtung von Mimik, Gestik und Verhalten wichtig.
- Eine Verlegung in ein Heim oder ein Krankenhaus sollte möglichst vermieden werden, da Ortswechsel in der letzten Lebensphase häufig eine große Belastung darstellen.
- Um ein menschenwürdiges Sterben im Heim oder im Krankenhaus zu ermöglichen, sollten Angehörige den Prozess begleiten können, auch außerhalb der Besuchszeiten.
- Wenn kein Einzelzimmer zur Verfügung steht, sollten die Sterbenden zumindest einen geschützten Raum haben, der Ruhe gewährleistet. „Allerdings dürfen sie nicht vergessen werden.“ (iss)