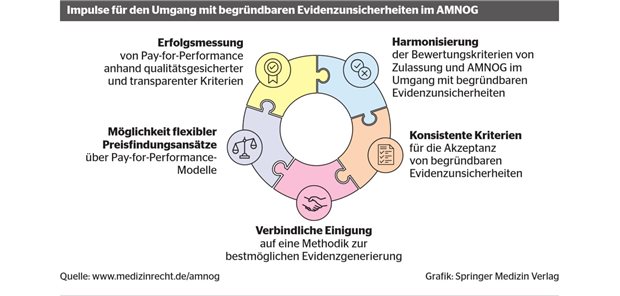AMNOG
Schneller Zugang zu neuen Arzneimitteln in Deutschland
Das AMNOG und die damit verbundene politische Entscheidung, dass Hersteller beim Markteintritt Preise autonom setzen können, hat dazu geführt, dass Deutschland international einen Spitzenplatz bei der Versorgung mit Innovationen hat. Unklar bleibt allerdings, welchen Einfluss Nutzenbewertungen auf ärztliche Therapieentscheidungen haben.
Veröffentlicht:
Das Plenum des Bundesausschusses entscheidet über den Zusatznutzen neuer Arzneimittel.
© GBA
Berlin. 1,7 Monate dauert es im Schnitt, bis ein neu zugelassenes Arzneimittel deutschen Patienten zur Verfügung steht, bei Orphan Drugs sind es im Schnitt nur 1,3 Monate. In anderen Ländern dauert es um ein Vielfaches länger, bis zu eineinhalb Jahren etwa in Frankreich.
Die Ursache dafür, so erklärte es Han Steutel, der Präsident des Verbandes forschender Pharma-Unternehmen (vfa) bei einem Symposion des Gemeinsamen Bundesausschusses anlässlich einer Zehn-Jahres-Bilanz des AMNOG, sei, dass Nutzenbewertungen und darauf aufsetzende Preisverhandlungen erst nach der Markteinführung starten. In anderen Ländern muss erst über Preise verhandelt werden, das verzögert die Markteinführung.
Ist der verhandelte Preis nicht lukrativ genug, kann der Hersteller immer noch entscheiden, den Markt erst gar nicht zu bedienen. Steutel erklärt den Versorgungsvorteil für Deutschland so: „Es ist für ein Unternehmen viel einfacher, dir Entscheidung zu treffen, ein neues Produkt erst gar nicht einzuführen als es später wieder vom Markt zu nehmen.“
Absatzhoffnungen in der Realität enttäuscht
Die Entscheidung des Gesetzgebers vor gut zehn Jahren, auf eine vierte Hürde zu verzichten, eröffnet Patienten die Chance auf Zugang zu Innovationen – mehr allerdings nicht. Denn es gibt keine gesicherten und eindeutigen Erkenntnisse darüber, in welchem Ausmaß der Ausgang von Nutzenbewertungen das ärztliche Verordnungsverhalten beeinflusst.
Ein Beispiel dafür ist das erste 2011 bewertete Präparat, Ticagrelor. Denn die Absatzhoffnungen, die sich der Hersteller aufgrund der Bewertung „beträchtlicher Zusatznutzen“ gemacht hatte, wurden in der Versorgungsrealität eher enttäuscht.
Ein wesentlicher Aspekt sei es, so Professor Bernhard Wörmann von der Deutschen Gesellschaft für medizinische Hämatologie und Onkologie, dass eine Innovation auf einen hohen „unmet medical need“ trifft, bei dem auch der Leidensdruck der Patienten sehr hoch sei.
Und hinzu tritt, dass Krankheiten, bei deren Behandlung der Effekt von Innovationen auf harte Endpunkte wie beispielsweise das Gesamtüberleben, gut und schnell beobachtbar sind – ein Umstand, der neue Therapieansätze in der Onkologie im Vergleich etwa zur Diabetologie in einen Vorteil versetzt, so Wörmann.
Gut, dass Fachgesellschaften mit im Boot sind
Einigkeit besteht zwischen allen am Nutzenbewertungsprozess Beteiligten, dass die bessere Einbindung der Fachgesellschaften einschließlich der Arzneimittelkommission der Ärzte – zuletzt vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschrieben – positive Effekte hat. Möglicherweise auch auf das ärztliche Verordnungsverhalten.
Dies werde allerdings eher von Leitlinien als von Nutzenbewertungsentscheidungen beeinflusst – aber die mit der Nutzenbewertung entstandene neue Qualität der Daten- und Studientransparenz beeinflusse inzwischen auch Leitlinien der Fachgesellschaften.
Zusätzlich stehen Ärzten nach mehrjährigen Vorarbeiten mit dem Arzt-Informations-System die Ergebnisse von Nutzenbewertungen als digitales Informationswerkzeug in ihrer Praxissoftware zur Verfügung. Handlungsleitend sei dabei gewesen, so Sibylle Steiner von der KBV, dass eine Informationsflut vermieden wird und gezielt relevante Informationen auf einen Blick zur Verfügung stehen. Wichtig sei dies auch für Hausärzte, von denen 90 Prozent AMNOG-Arzneimittel einsetzen.
Diese Informationen haben allerdings auch Grenzen, so Professor Dirk Müller-Wieland von der Deutschen Diabetes Gesellschaft: Ärzte stellten nicht nur reine Präparatebetrachtungen und -vergleiche an, sondern hätten eher komplexere Therapiestrategien im Blick. Das gelte insbesondere für chronische, von Komorbiditäten begleitete Krankheiten.
In diesem Zusammenhang stelle sich dann aus ärztlicher Sicht auch die Frage, was etwa eine Add-on-Therapie mit einer Innovation zusätzlich nütze. Das, so Müller-Wieland und Wörmann, werde in einer isolierten Nutzenbewertung nicht erfasst.