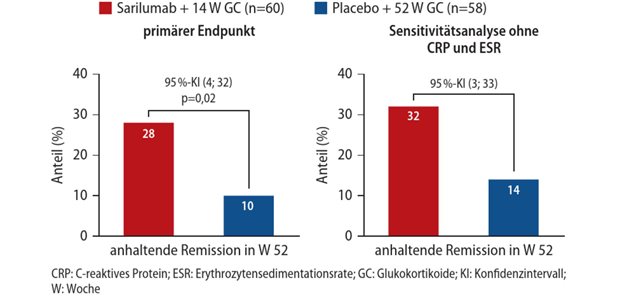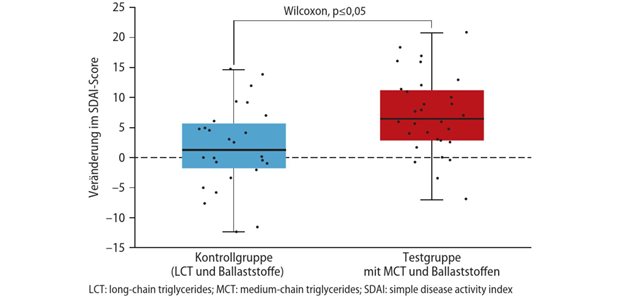Schmerzen
Cannabinoid-Verordnung mit Hürden
Kassen sind mitunter hartleibig, bis sie die Notwendigkeit von Medizinalhanf-Rezepten akzeptieren. Das zeigt ein Blick in die Versorgungsrealität.
Veröffentlicht:
Die Verordnung von Cannabisprodukten auf Rezept ist per Gesetz vereinfacht worden.
© Africa Studio / stock.adobe.com
Stuttgart. Seit März 2017 können Vertragsärzte in Deutschland Cannabis-basierte Arzneimittel zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) verordnen – Anspruch auf diese Arzneimittel haben Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Der Anspruch erstreckt sich auf die Versorgung mit Cannabis in Form getrockneter Blüten oder Extrakte in standardisierter Qualität sowie mit Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon.
Wie Isabel Kuhlen, Rechtsanwältin und Apothekerin aus Vellmar, vor Kurzem beim Satellitensymposium „Therapie mit Cannabinoiden – Indikationen jenseits der MS“ im Rahmen des 92. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Neurologie Ende September in Stuttgart erklärte, gehört zu den Genehmigungsvoraussetzungen für eine Verordnungsfähigkeit zu Lasten der GKV das Vorliegen einer „schwerwiegenden Erkrankung“ sowie die fehlende Möglichkeit der Therapie durch allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Alternativtherapien.
69% der genehmigten Cannabisrezepte betrafen laut einer BfArM-Auswertung die Indikation Schmerz.
Nach Auslegung der GKV sei eine Erkrankung „schwerwiegend“ im Sinne des Paragrafen 33 Arzneimittelrichtlinien, „wenn sie lebensbedrohlich oder aufgrund der Schwere der durch sie verursachten Gesundheitsstörung die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beeinträchtigt ist“. Bislang seien in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum „Off-Label-Use“ Multiple Sklerose, Krebs-Leiden und Aids als schwerwiegende Erkrankungen anerkannt worden.
Was sind die häufigsten therapierten Symptome?
Erste Zahlen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu genehmigten Anträgen haben ergeben, dass am häufigsten Schmerzen (69 Prozent), Spastik (elf Prozent) und Anorexie/Wasting (acht Prozent) als primär therapierte Symptomatik genannt wurden. Anträge auf Kostenübernahme würden am häufigsten mit dem Verweis auf Therapiealternativen abgelehnt, gab Kuhlen zu bedenken. So gingen die Krankenkassen davon aus, dass eine potenzielle Alternativtherapie nicht anwendbar ist, wenn die Therapie bereits erfolglos durchgeführt wurde, Kontraindikationen bestehen oder medizinisch begründete und nachvollziehbar nicht tolerierbare Nebenwirkungen zu erwarten sind.
Bei Letzteren genüge es nicht, nur allgemein auf die Möglichkeit des Eintritts von Nebenwirkungen bei Einsatz eines anerkannten und dem medizinischen Standard entsprechenden Arzneimittels zu verweisen. Zudem könne es nicht nur für die Antragsstellung, sondern wegen der ärztlichen Meldepflicht für unerwünschte Nebenwirkungen auch berufsrechtlich problematisch sein, Nebenwirkungen geltend machen zu wollen, die weder in der Fachinformation vorkämen, noch entsprechend gemeldet würden.
Hinsichtlich der dritten Genehmigungsvoraussetzung, dem „Bestehen einer nicht ganz entfernt liegenden Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome“, vertritt das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz die Auffassung, dass kein Wirksamkeitsnachweis nach den Maßstäben evidenzbasierter Medizin verlangt wird. So genügten Indizien, die sich auch außerhalb von Studien oder vergleichbaren Erkenntnisquellen oder Leitlinien finden könnten. Allerdings würden „allein positive Erfahrungen des Versicherten aufgrund eines schon erfolgten Einsatzes von Medizinal-Cannabis“ nicht ausreichen. (ys)