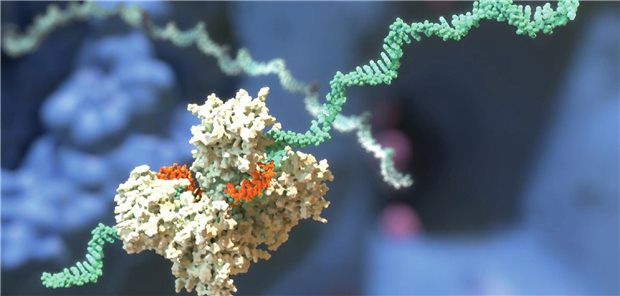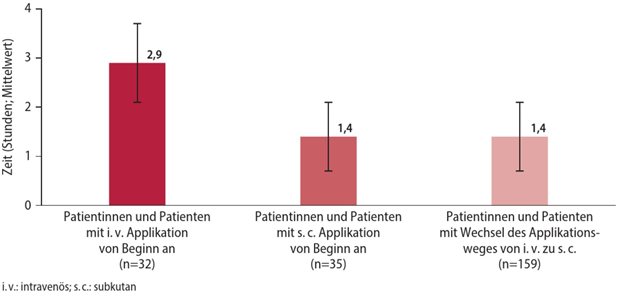COVID-19
Verursacht Omikron weniger schwere Erkrankungen? Studie gibt Hinweise
Befunde aus vorläufigen Studien sprechen für eine reduzierte Pathogenität der Omikron-Variante von SARS-CoV-2. Definitive Aussagen sind aber noch nicht möglich und die hohe Kontagiosität bleibt ein großes Problem.
Veröffentlicht:
Rasante Ausbreitungsgeschwindigkeit: Die Omikron-Variante bereitet Epidemiologen und Infektiologen große Sorgen.
© Nikolay / stock.adobe.com
Neu-Isenburg. Die Omikron-Variante ist im Vergleich zu anderen SARS-CoV-2-Varianten deutlich ansteckender, weshalb mit der weiteren Ausbreitung auch in Deutschland eine starke Zunahme der Infektionen erwartet wird. Möglicherweise ist die Problemvariante aber weniger pathogen. Hinweise darauf gibt es in Studien aus England, Schottland und Südafrika.
Auf der britischen Insel ist Omikron bereits die dominierende SARS-CoV-2-Variante. Mehr als 100.000 Infektionen wurden dort am Mittwoch registriert. In der schottischen Preprint-Studie war deshalb ermittelt worden, wie viele der Betroffenen hospitalisiert werden müssen. Gemessen an den Erfahrungen mit der vorher dominierenden Delta-Variante wären dort 47 Klinikaufnahmen zu erwarten gewesen. Bisher seien es aber nur 15 gewesen. Allerdings gab es in der Studie nur wenig Fälle und zudem wenige ältere Risikopatienten.
Daten aus Südafrika
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine vorläufig und noch nicht begutachtete Studie aus Südafrika (medRxiv 2021; online 21. Dezember). Darin war das Risiko von Omikron-Infizierten für eine Hospitalisierung im Vergleich zu früheren Wellen um 70 bis 80 Prozent reduziert. Allerdings habe sich der Krankheitsverlauf bei den wenigen Omikron-Patienten in der Klinik nicht von Infektionen mit anderen Varianten unterschieden.
Die jetzt möglicherweise beobachtete reduzierte Pathogenität ließe sich auf zwei mögliche Ursachen zurückführen: Zum einen könnten Mutationen bei der Omikron-Variante grundlegende Eigenschaften von SARS-CoV-2 verändert haben. Zum anderen trifft die Variante auf Bevölkerungen mit bereits hoher Herdenimmunität entweder durch Impfung oder durchgemachte Infektionen. Eine Modellierung des Imperial College in London geht in einer Bevölkerung ohne Immunschutz bei Omikron im Vergleich zu Delta von einem um 11 Prozent reduzierten Risiko für den Besuch einer Klinik-Notaufnahme aus, durch die bisher in England erreichte Herdenimmunität sei dieses Risiko aber um 25-30 Prozent reduziert.
In-vitro Studien mit Omikron-Pseudoviren
Auch vorläufige Daten einer experimentellen Arbeit sprechen für eine möglicherweise geringere Pathogenität der Omikron-Variante (bioRxiv 2021; online 22. Dezember). Britische Forscher haben für die Studie Omikron-Pseudoviren generiert (ungefährliche Laborviren mit dem Omikron-Spike-Protein auf der Oberfläche). Sie konnten dann die Fähigkeit dieses Pseudovirus testen, verschiedene Zellen zu infizieren und Zell-Zell-Fusionen anzuregen (diese werden mit schweren Krankheitsverläufen assoziiert). Verglichen wurden die Ergebnisse mit Tests von Delta-Spike-Protein-Pseudoviren oder Wildtyp-Spike-Protein-Pseudoviren.
Ergebnis: Im Vergleich zu dem Delta-Pseudovirus konnte das Omikron-Pendant Lungenzellen und Zellen von Lungenorganoiden schlechter infizieren. Zudem konnte das Omikron-Pseudovirus deutlich schlechter Zell-Zell-Fusionen anregen. Das Fazit des Teams: Omikron könne zwar aufgrund der vielen Mutationen im Spike-Protein einer bestehenden Immunantwort teilweise entkommen. Die Virusvariante könne aber Zellen nicht so gut infizieren und sich ausbreiten.
Die Infektiologin und Professorin Isabella Eckerle von der Universität Genf in der Schweiz mahnt zu Zurückhaltung bei der Interpretation: Die Daten sollten nur mit sehr viel Vorsicht auf die tatsächliche Situation im Mensch extrapoliert werden. „Die Infektion im Menschen ist ja wesentlich komplexer als in einem Organoid, und wichtige Komponenten fehlen hier – zum Beispiel das adaptive Immunsystem, das eine wesentliche Rolle bei der Modifikation des Krankheitsbilds spielt.“
Anteil der Bevölkerungsimmunität schwer zu beurteilen
Ihr Fazit: „Aktuell erscheinen mir die Daten zur Krankheitsschwere von Omikron noch etwas zu dünn, um daraus allgemeingültige Aussagen zu treffen. Ein ganz entscheidendes Problem wird bei der Bewertung der Daten aus Südafrika aber deutlich: Je vielfältiger und diverser die zugrunde liegende Immunität der Bevölkerung wird – durch Impfung oder Infektion, vergangene Varianten-Zirkulation, regionale Unterschiede – umso schwieriger wird es, die Unterschiede in der Krankheitspräsentation entweder dem Virus selbst oder der Grundimmunität zuzuschreiben“, betont die Virologin in einer Stellungnahme für das „Science Media Center“.
Allgemein betonten die beteiligten Wissenschaftler darüber hinaus: Auch bei einer reduzierten Pathogenität wäre die in den nächsten Wochen zu erwartende hohe Zahl der Omikron-Betroffenen trotzdem für die Kapazitäten von Kliniken und Praxen ein großes Problem.