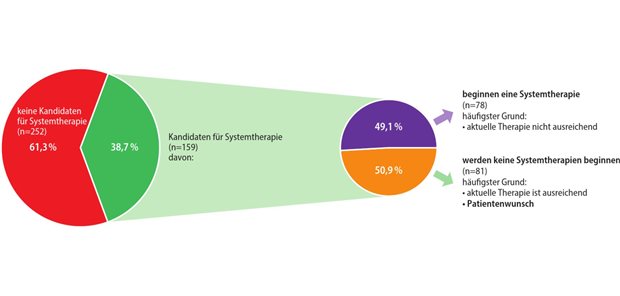Infektionen
Wie HPV die Hautkrebsentstehung triggert
Humane Papillomviren programmieren ihre Wirtszellen um und begünstigen auf diese Weise die Hautkrebsentstehung.
Veröffentlicht:München. Humane Papillomviren (HPV) können sowohl die menschliche Schleimhaut als auch verhornende Haut infizieren. Dies kann zu gutartigen und bösartigen Veränderungen im infizierten Gewebe führen.
Für bestimmte Krebsarten, zum Beispiel Zervix- und Tonsillenkrebs, ist der Zusammenhang zwischen einer Infektion mit HPV und der sogenannten alpha-Gruppe bewiesen, teilt die Wilhelm Sander-Stiftung mit. Viren der beta-HPV-Gruppe sind sehr weit verbreitet und werden durch das Immunsystem in Schach gehalten, sodass die Virusvermehrung auf sehr niedrigem Niveau stattfindet.
Bei Menschen mit chronischer Immunschwäche, besonders bei solchen mit Spenderorgan, bei denen ja das Immunsystem dauerhaft supprimiert werden muss, um eine Abstoßung zu verhindern, kommt es zu einer abnormalen Vermehrung von beta-HPV in der Haut, so die Stiftung. Dies begünstigt die Bildung von Hautkrebsvorstufen und letztlich auch die Entstehung von weißem Hautkrebs.
Auf welche Weise die Viren die Krebsentstehung begünstigen, ist bis heute noch nicht im Detail verstanden. Im Rahmen eines von der Wilhelm Sander-Stiftung geförderten Forschungsprojektes konnte die Arbeitsgruppe von Professor Baki Akgül vom Institut für Virologie der Uniklinik Köln nun belegen, dass HPV mittels eines bislang unbekannten Mechanismus Einfluss auf infizierte Zellen nimmt und sowohl die Herstellung zellulärer Proteine als auch deren Stabilität beeinflusst (Virology. 2019; 535:136-143)
Vorhandensein von Protein e7 reicht aus
Das Forscherteam um Akgül nutzte für seine Untersuchungen 2D-Zell-Kultursysteme, 3D-Hautkulturmodelle und transgene Mäuse und konnte so belegen, dass allein das Vorhandensein des viralen Proteins E7 ausreicht, um infizierte Hautstammzellen vermehrt in Krebsstammzellen umzuprogrammieren.
So konnten die Wissenschaftler molekulare Mechanismen aufdecken, durch die Virus-positive Zellen ihren Gewebeverband verlassen, in andere Gewebeschichten einwandern und krebszellartiges Verhalten entwickeln. Diesem Vorgang der Zellinvasion liegt einerseits die Fähigkeit des Proteins E7 zu Grunde, Zell-Zell-Kontakte von infizierten Hautzellen zu schwächen, was die Grundvoraussetzung für eine Ablösung aus dem Gewebeverband ist, heißt es in der Mitteilung.
Andererseits habe die Arbeitsgruppe eine Interaktion zwischen einer Familie von Zelloberflächenproteinen, den sogenannten Integrinen, und dem Bindegewebsprotein Fibronektin gezeigt. Es gelang den Kölner Forschern nachzuweisen, dass diese gegenseitige Einflussnahme ebenfalls begünstigend für die Entstehung von Krebs ist.
Des Weiteren konnten die Wissenschaftler demonstrieren, dass das Virus Einfluss auf die Genexpression infizierter Zellen nimmt. Es gelang ihnen der Mitteilung zufolge zudem, einen völlig neuen Mechanismus aufzudecken, über den das Virus die Stabilität von wichtigen zellulären Proteinen beeinträchtigt, die bei der Zellteilung und der DNA-Reparatur eine tragende Rolle spielen.
So konnten sie erstmalig eine Kooperation der viralen Proteine E6 und E7 belegen, welche offenbar gemeinsam Einfluss auf die Stabilität wichtiger zellulärer Regulatoren über den Protein-Abbauprozesses der sogenannten Autophagie nehmen (Int J Cancer. 2019; 145(3): 797-806). (eb)