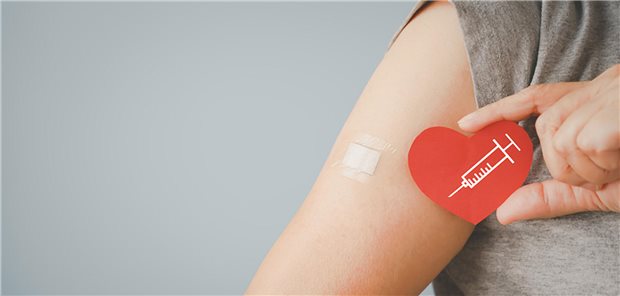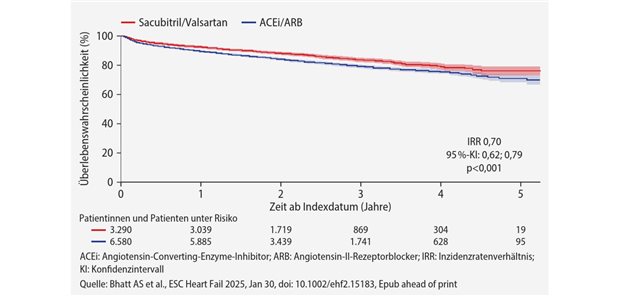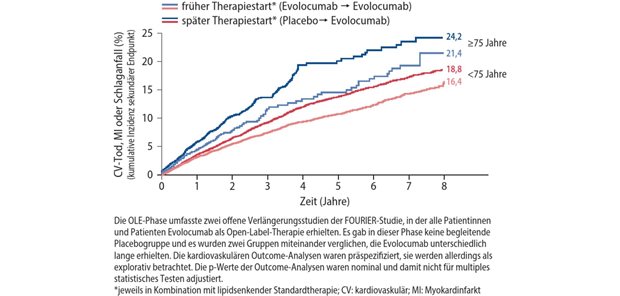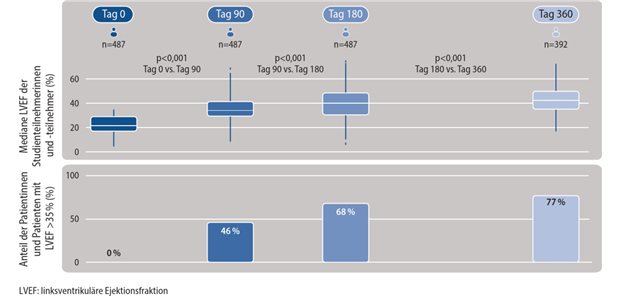Ergebnisse kardiologischer Diagnostik
Wie fit sind Leistungssportler nach COVID-19?
Leistungssportler verlieren nach SARS-CoV-2-Infektion offenbar nicht an Fitness, so eine Studie. Überraschenderweise war der Zustand sogar besser als vorher, wobei wenige weiterhin Beschwerden hatten.
Veröffentlicht:
Die Sportler wurden unter anderem mit Echokardiografie untersucht (Symbolbild mit Fotomodell).
© familylifestyle / stock.adobe.com
Budapest. Die meisten Leistungssportler und -sportlerinnen erreichen drei Monate nach einer SARS-CoV-2-Infektion wieder ein zufriedenstellendes Fitnesslevel, hat jetzt eine Studie ergeben (Sci Rep. 2022; online 15. Dezember).
„Mit einem sinnvoll aufgebauten Trainingsplan können die meisten Athleten drei Monate später eine gute körperliche Fitness erreichen, und die Infektion hat bei ihnen keinen langfristigen Einfluss auf die Sportlerkarriere“, lautet das Fazit der Autoren um den Sportkardiologen Dr. Mate Babity von der Semmelweis Universität in Budapest.
Befürchtungen haben sich nicht bestätigt
Damit hat sich die Befürchtung, dass eine Corona-Infektion das Leistungsvermögen vieler Sportler dauerhaft einschränken könnte, in dieser Studie nicht bestätigt. Wichtig: Die meisten Teilnehmer in dieser Untersuchung hatten während der Akutinfektion keine Beschwerden, nur wenige litten an milden bis moderaten Symptomen.
Insgesamt haben Babity und sein Team bei 165 ungarischen Leistungssportlern und -sportlerinnen (sie trainierten im Mittel 16 Stunden pro Woche) durchschnittlich 93,5 Tage nach der Infektion eine kardiologische Untersuchung sowie eine Spiroergometrie vorgenommen. Die Teilnehmer kamen aus unterschiedlichen Sportarten (etwa Basketball, Wrestling, Eishockey), die meisten waren Männer (n=122), das mittlere Alter lag bei 20 Jahren. Der Basis-Kardio-Check bestand aus einem 12-Kanal-EKG, der Messung kardialer Biomarker und einer Echokardiografie.
Zusätzlich wurden 18 weitere Sportler, davon 9 Amateursportler, separat untersucht. Diese hatten bei einem ersten kardiologischen Check-up kurz nach der Infektion auffällige Befunde oder bleibende Symptome gehabt.
Kein Leistungsabfall – im Gegenteil
In der Leistungsdiagnostik drei Monate nach der Infektion erzielten die Athleten 94,7 Prozent (+/– 4,3 Prozent) ihrer maximalen Herzfrequenz, ihre maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) lag im Schnitt bei 50,9 (+/– 6,0) ml/kg/min und das maximale Atemminutenvolumen bei 143,7 (+/– 30,4) l/min. Die Sportkardiologen um Babity bewerten diese Werte als „zufriedenstellend“.
Bei 62 Sportlern waren Spiroergometrie-Befunde aus der Zeit vor der SARS-CoV-2-Infektion vorhanden. Vergleicht man diese Werte mit denen nach der Infektion, lässt sich bei den meisten Sportlern kein Leistungsknick feststellen. Im Gegenteil, VO2max und das Atemzeitvolumen hatten sich nach der Infektion im Schnitt sogar verbessert. Der überraschende Leistungszuwachs hat Babity und Kollegen zufolge aber nichts mit der Infektion zu tun. Dieser sei auf zu diesem Zeitpunkt anstehende größere Wettkämpfe wie die Olympischen Spiele 2021 zurückführen, erläutern die Autoren. Die Athleten hätten deshalb im Vorfeld intensive Trainingseinheiten ausgeübt. Außerdem hatte die Leistungsdiagnostik, die vor der Infektion gemacht wurden, nicht unbedingt in derselben Trainingsphase stattgefunden wie die Post-COVID vorgenommene Leistungsdiagnostik,
Nur wenige Athleten mit einem Leistungsknick
Trotz dieser Umstände konnten die Sportkardiologen bei sechs Sportlern – immerhin bei 9,7 Prozent – einen beträchtlichen Leistungsabfall (> 10 Prozent Abfall der VO2max) registrieren. Fünf der insgesamt 174 untersuchten Leistungssportler (2,8 Prozent) klagten zudem weiterhin über COVID-19-assozierte Symptome.
Außerdem konnten die Mediziner in den kardiologischen Untersuchungen bei sieben Athleten belastungsinduzierte Arrhythmien, bei drei Personen deutliche horizontale/ deszendierende ST-Streckensenkungen, eine ischämische Herzerkrankung und in sieben Fällen eine Hypertonie feststellen. Zudem wiesen zwei Personen erhöhte Pulmonalisdrücke auf, bei einem Athleten war ein trainingsbezogener Anstieg des hochsensitiven Troponin T nachweisbar. Wobei bei all diesen Fällen keine direkte Verbindung mit der Infektion hergestellt werden konnte, betonen die Autoren.
Mehrfach Nebenbefunde ohne Bezug zu COVID
Bei der Untersuchung der 18 Sportler mit vorgeblichen Post-COVID-Beschwerden, konnten die Sportkardiologen in einem Falle eine durchgemachte Myokarditis diagnostizieren, die sie tatsächlich auf die SARS-CoV-2-Infektion zurückführen. Bei jeweils einem Athleten wurde eine ischämische Herzerkrankung und eine Koronararterienanomalie, bei zwei weiteren wurden ausgeprägte ventrikuläre oder atriale Rhythmusstörungen nachgewiesen. Bis auf die Myokarditis deklarieren die Autoren diese Neudiagnosen als Nebenbefunde, da sie nicht mit der COVID-Erkrankung in Verbindung stehen. Trotz allem werde daran deutlich, wie wichtig die Implementierung kardiologischer Untersuchungen bei Athleten nach einer SARS-CoV-2-Infektion sei, betonen Babity und Kollegen, denn diese führten zu einem nie dagewesenen weltweiten Athleten-Screening.
Alles in allem gehen die Autoren aber davon aus, dass eine kardiale Beteiligung bei Athleten nach asymptomatischen oder mild symptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen selten vorkommt: „Der Anteil der Leistungssportler mit lange andauernden Symptomen war gering und der Anteil von auffälligen Befunden, die mit der SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung stehen, war ebenfalls gering“, begründen sie ihr Annahme.
Mehr Informationen zur Kardiologie unter www.springermedizin.de