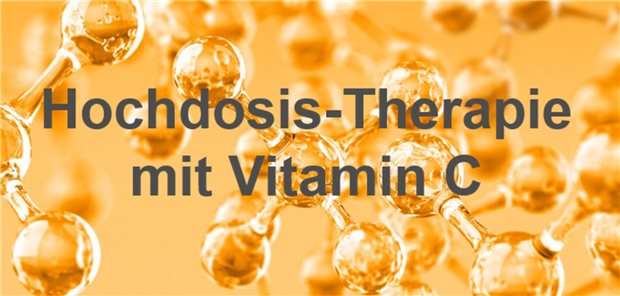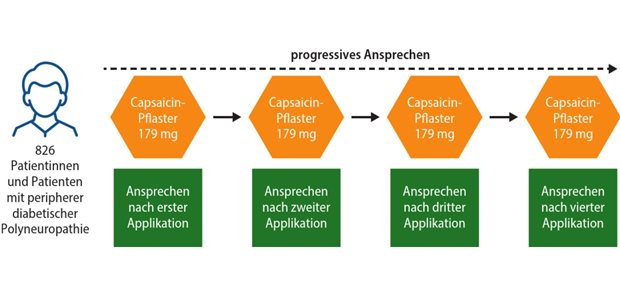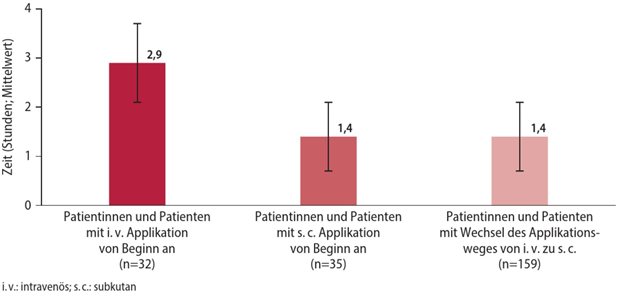Palliativmedizin
Fachgesellschaft ohne klare Position zur Suizidassistenz
Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin ist uneins über die Folgerungen aus dem Karlsruher Urteil zur Suizidassistenz – und hat einen Pandemieplan für den Fall einer zweiten Corona-Welle präsentiert.
Veröffentlicht:
Gehört oft mit zur palliativen Betreuung: ein ganzes Arsenal von schmerzlindernden Medikamenten und Tropfen.
© picture alliance / Sven Simon
Wiesbaden. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat gegenwärtig keine einheitliche Position dazu, wie mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Suizidassistenz umgegangen werden soll. Es gebe dazu ein „weites Meinungsspektrum“ im Vorstand, sagte DGP-Präsident Professor Lukas Radbruch bei einer Online-Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung des diesjährigen DGP-Kongresses in Wiesbaden.

Mahnt den Gesetzgeber zur großen Sorgfalt bei einer möglichen Neuformulierung des Paragrafen 217: Professor Lukas Radbruch, Präsident der DGP.
© Universitätsklinikum Bonn
Das Karlsruher Urteil habe ihn wie alle andere auch „überrascht“, bekannte Radbruch. Es gebe anhaltende Diskussionen unter Palliativmedizinern darüber, wie die vom Gericht geforderte Freiverantwortlichkeit der Betroffenen, die um Suizidassistenz bitten, überprüft werden könne. Am Ende dieses Prozesses gehe es um die Frage der Verabreichung eines tödlichen Medikaments. „Dafür habe ich nicht Medizin studiert“, machte Radbruch seine ablehnende Haltung deutlich.
Von Erfahrungen aus dem Ausland lernen
Konsens in der DGP dagegen sei, dass es Aufgabe aller Professionen sei, Schwerstkranke durch „aktive Aufklärung“ über Alternativen zum Suizidwunsch zu informieren, sagte Dr. Bernd Oliver Maier, Vizepräsident des DGP. Bei der Neuformulierung des vom Bundesverfassungsgericht verworfenen Paragrafen 217 Strafgesetzbuch werde es auf jede Nuance ankommen, machte Dr. Kurt Schmidt, Kongresspräsident, Leiter des Zentrums für Ethik in der Medizin in Frankfurt deutlich. Hier könne man viel aus den Erfahrungen in Nachbarländern lernen.
So sei beispielsweise Tötung auf Verlangen in den Niederlanden nach wie vor verboten und werde nur bei Einhaltung genauer Vorschriften nicht strafrechtlich verfolgt. In der niederländischen Gesellschaft habe sich dagegen sukzessive eine andere Wahrnehmung etabliert.
Die Gefahr der „schiefen Ebene“
Radbruch mahnte zur großen Sorgfalt bei der gesetzlichen Formulierung eines neuen Paragrafen 217: „Welche klaren Regelungen lassen sich durchhalten?“ Denn der DGP-Präsident sieht im holländischen Beispiel eine Bestätigung für die Gefahr der „schiefen Ebene“: Das dortige Sterbehilfegesetz sei seit seiner Etablierung mehr als 30 Mal verändert – und ausgeweitet – worden.
Lernen könne man von Holland allerdings hinsichtlich der gesellschaftlichen Debatte über das Thema, sagte Maier. In Deutschland hingegen bestimmten bisher häufig „dogmatische Argumentationen“ den Diskurs. Die aktuelle Diskussion stelle die DGP vor die Herausforderung, wie „Fachgesellschaften die Pluralität von Meinungen in ethisch brisanten Fragen unter einem Dach versammeln können, ohne ihr Profil zu verlieren“, so Schmidt.
Psychosoziale und spirituelle Begleitung kam zu kurz
Ein gemischtes Fazit zog die DGP zu den Erfahrungen der palliativmedizinischen Versorgung in der Corona-Pandemie. Bei einzelnen Palliativstationen habe die Drohung im Raum gestanden, dass sie geschlossen werden könnten, um Betten für COVID-19-Patienten freizumachen, berichtete Radbruch. Eine wichtige Erkenntnis sei, dass sich auch unter schwierigen Umständen Palliativmedizin nicht auf die pharmakologische Therapie reduzieren lässt, sagte Maier im Hinblick etwa auf Besuchsverbote in Heimen. Dadurch sei die psychosoziale und spirituelle Begleitung der Patienten zu kurz gekommen.
Dies bestätigte Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. Gleich zu Beginn der Pandemie habe eine Taskforce die Situation in über 30 Krebszentren in Deutschland erhoben. Dabei seien die Einschränkungen in der palliativmedizinischen Versorgung offenbar geworden. „Das hat uns nicht gefallen“, sagte Nettekoven. „Vereinzelt“ sei zu hören, dass Tumor-Diagnosen zu spät gestellt wurden.
Einheitlicher Pandemieplan für Palliativmedizin ist in Arbeit
Nettekoven stellte in Frage, ob COVID-19-Patienten tatsächlich vorrangig an Universitätskliniken behandelt werden sollten – dort, wo auch die großen Krebszentren angesiedelt sind. Die gesammelten Erfahrungen und Einsichten während der ersten Phase der Pandemie sollen in einen einheitlichen Pandemieplan für die Palliativversorgung münden. Dieser wird im Rahmen eines vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekts erarbeitet.
Nettekoven machte deutlich, dass er bei der palliativen Versorgung – insbesondere in ländlichen Regionen – noch Luft nach oben sieht. Aktuell gebe es nur in zehn von über 30 medizinischen Fakultäten einen entsprechenden Lehrstuhl. Sechs davon seien durch die Deutsche Krebshilfe finanziert.
News per Messenger
Neu: WhatsApp-Kanal der Ärzte Zeitung
Ist Suizidassistenz ein Job für Ärzte – oder doch nicht?
Ärztekammern brüten über neue Sterbehilfe-Formulierung