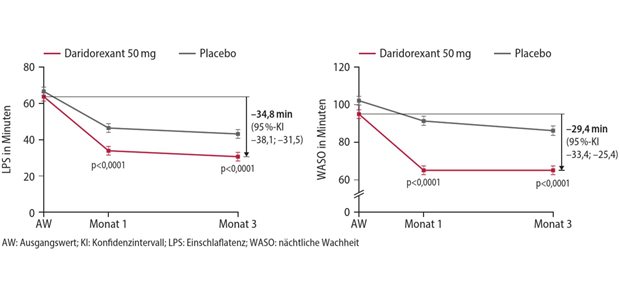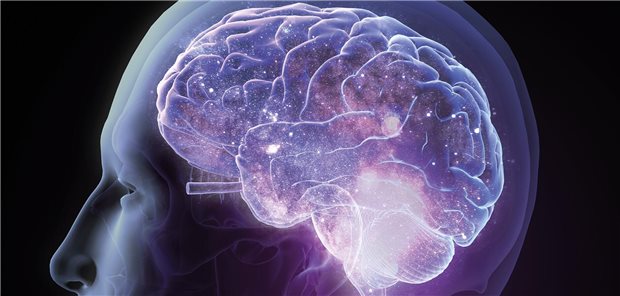Nikotinsucht
Raucher: „Entwöhnung kommt oft viel zu spät“
Bis zu zehn Versuche brauchen Raucher, um tabakabstinent zu werden, sagt Professor Stephan Mühlig aus Chemnitz. Nötig seien strukturierte und finanzierte Entwöhnungsprogramme. Sind Ärzte beteiligt, wirkt sich das günstig auf die Langzeitabstinenz aus.
Veröffentlicht:
Wie stark ist der Wunsch aufzuhören? Der körperliche Abhängigkeitsgrad lässt sich unter anderem mit dem praxistauglichen Fagerström-Test mit nur sechs Items bestimmen.
© methaphum / stock.adobe.com
Ärzte Zeitung: Professor Mühlig, die Mehrheit der Rauchenden schaffe den Ausstieg ohne formale Hilfe, heißt es in der S3-Leitlinie Tabakkonsum. Wer braucht also strukturierte Entwöhnungsprogramme?
Professor Stephan Mühlig: Dafür gibt es evidenzbasierte Indikationen, zum Beispiel den Grad der Suchtmittelabhängigkeit. Etwa 40 Prozent der Raucher entwickeln ein körperliches Abhängigkeitssyndrom.
Die meisten aufhörbereiten Raucher verspüren nach dem Rauchstopp daher keine gravierenden Entzugserscheinungen, sondern „nur“ das subjektive Suchtverlangen, das Craving. Dabei stehen kognitive Prozesse, vor allem lernpsychologische Konditionierungen und Verstärkung im Vordergrund. Daraus ergeben sich unterschiedliche therapeutische Zugänge für die verschiedenen Problemlagen der Tabakabhängigkeit oder -sucht.
Und das bedeutet ...?

Professor Stephan Mühlig ist Leiter der Psychosozialen Beratungsstelle und Raucherambulanz, TU Chemnitz.
© TU Chemnitz / Jacob Müller
Mühlig: ...dass es irgendwann im Leben tatsächlich die meisten Raucher schaffen aufzuhören, auch ohne professionelle Hilfe. Während über alle Altersgruppen hinweg etwa ein Viertel bis ein Drittel der Deutschen raucht, finden wir bei über 65-jährigen Menschen nur noch eine Raucherquote von etwa zehn Prozent.
Das liegt nicht primär an der Übersterblichkeit von Rauchern, vielmehr ist der Anteil der Ex-Raucher unter den Älteren im Vergleich mit Jüngeren überproportional hoch. Aber: Das Problem ist, sie schaffen es viel zu häufig viel zu spät, im Durchschnitt nach fünf bis zehn Versuchen, die sich teilweise über Jahrzehnte erstrecken können. Bis dahin sind längst irreversible Schäden und rauchbedingte Krankheiten verursacht worden.
Wir wollen Menschen möglichst früh zum Rauchstopp zu motivieren. Gerade langjährige und starke Raucher, körperlich abhängige Raucher, besonders stressvulnerable Raucher und Menschen mit psychischen Auffälligkeiten benötigen dafür oft professionelle Hilfe.
Wie lässt sich erkennen, ob jemand professionelle Hilfe braucht?
Mühlig: Der körperliche Abhängigkeitsgrad lässt sich unter anderem mit dem praxistauglichen Fagerström-Test mit nur sechs Items bestimmen. Die erste Frage lautet zum Beispiel, wie viel Zeit vom morgendlichen Aufstehen bis zur ersten Zigarette vergeht. Das zweite Kriterium betrifft die Motivation und persönliche Handlungskompetenz.
Wir stellen in unseren Entwöhnungskursen zwei Fragen, die auf einer numerischen Skala von 1-10 beantwortet werden sollen: „Wie stark ist Ihr Wunsch, jetzt aufzuhören und für immer rauchfrei zu bleiben?“ und „Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie das schaffen?“
Auf diese Weise können wir sehr einfach den Raucher-Motivationssubtyp identifizieren und dies für das individuelle therapeutische Vorgehen berücksichtigen. Die Mehrheit unserer Teilnehmer in den Raucherkursen ist stark motiviert, aber die Zuversicht fehlt.
In der ATEMM-Studie haben Sie und Ihre Kollegen bei entwöhnungswilligen COPD-Patienten eine Rauchstoppquote über ein Jahr bei knapp 50 Prozent der Teilnehmer erreicht ...
Mühlig: Diese hohe Erfolgsquote hat uns selbst überrascht, das ist mehr als wir aus ähnlichen Studien kennen und als wir in unserer eigenen verhaltenstherapeutischen Raucherambulanz erreichen. Ein Erfolgsfaktor war sicher die Kursdurchführung in den pneumologischen Facharztpraxen durch die vorher von uns trainierten Ärzte.
Die im Verlauf des Jahres mindestens einmal im Quartal stattfindende ärztliche Untersuchung hat zudem für eine persönliche Anbindung und für eine gewisse Verbindlichkeit gesorgt. Ich denke, die Teilnehmer fühlten sich dadurch zusätzlich bestärkt, die Abstinenz durchzuhalten: Mein Arzt interessiert sich dafür, fragt mich danach und unterstützt mich dabei. Das hat eine nicht zu unterschätzende Wirkung!
Wie viele Teilnehmer hatte die Studie?
Mühlig: In Thüringen und Sachsen haben wir etwa 870 Teilnehmer rekrutiert, über 500 nahmen das Maximalprogramm wahr, die anderen bildeten die Kontrollgruppe mit einem Minimalprogramm, das den ärztlichen Rat zum Rauchstopp, eine Kurzmotivierung und Informationen über lokale Tabakentwöhnungsangebote beinhaltete.
Das Entwöhnungsprogramm bestand in dreistündigen Gruppensitzungen an drei Tagen im Abstand von jeweils einem Monat. Die Teilnehmer wurden in den Praxen betreut, wir Psychologen waren begleitend supervidierend tätig und haben die telefonische Nachbetreuung mit monatlichen proaktiven Anrufen bei allen Teilnehmern übernommen.
In den Sitzungen wurde über Gesundheitsschäden, Suchtmechanismen und den Nutzen des Nichtrauchens aufgeklärt, die Aufhörmotivation gestärkt sowie Methoden der Rauchstoppvorbereitung und des Umganges mit Entzugserscheinungen und Craving, die Möglichkeiten der medikamentösen Unterstützung und Strategien zur Rückfallprophylaxe vermittelt.
Was ist noch wichtig für den individuellen Therapieerfolg?
Mühlig: Gerade auch COPD-Patienten muss der Bezug zwischen persönlichem Rauchverhalten und der Krankheit sehr klar gemacht werden. Zwar weiß praktisch jeder Bundesbürger, dass Rauchen schädlich ist. Dennoch überwiegt der Glaube, man selbst werde schon nicht betroffen sein. Wir nennen das „Unverwundbarkeitsillusion“.
Viele Raucher wiegen sich in falscher Sicherheit. Der erste Therapieschritt besteht also darin, den Zusammenhang für jeden individuellen Fall so deutlich zu machen, dass er auch angenommen wird: Die Krankheit hat etwas mit mir, mit meinem Verhalten zu tun! Zum anderen ist es wichtig, die Zuversicht in Bezug auf den Erfolg der Entwöhnungstherapie zu stärken und konkrete Strategien an die Hand zu geben.
Gab es Erfahrungen in der ATEMM-Studie, die Sie außerdem überrascht haben?
Mühlig: Wir hatten den Teilnehmern freigestellt, ob sie Medikamente nehmen wollen oder nicht. Fast 90 Prozent der Teilnehmer nahmen das Angebot der Ärzte für eine vollfinanzierte medikamentöse Begleitung in Anspruch, vor allem Vareniclin oder Nikotinersatzprodukte.
Das erstaunt auf den ersten Blick, weil ja keineswegs alle körperlich abhängig waren. Dahinter könnte das Bedürfnis stehen, sich zusätzlich abzusichern. Viele süchtige Patienten befürchten ein stark eingeschränktes Wohlbefinden, verminderte Leistungsfähigkeit. Man glaubt, das nicht aushalten zu können. Das Wissen um ein zur Verfügung stehendes Medikament wirkt hierbei initial ermutigend und im Verlauf entlastend.
Welche Konsequenzen hat die an der Studie beteiligte AOK Plus gezogen?
Mühlig: Die AOK in Sachsen und Thüringen übernimmt für ihre Versicherten die Kosten der Entwöhnungstherapie – allerdings mit einer Einschränkung. Die Medikamentenkosten dürfen die Kassen aufgrund der derzeitigen Regelungen im SGB V nicht erstatten, selbst wenn sie es wollten. Da ist der Gesetzgeber gefragt.
Wie notwendig ist die Rückfallprophylaxe während und nach abgeschlossener Erstintervention?
Mühlig: Sie ist von zentraler Bedeutung. Der entscheidende Punkt ist die Verstetigung des Therapieeffekts mit entsprechender Vorbereitung der Klienten. Leider ist die Studienlage zur Wirksamkeit von Rückfallinterventionen bislang noch nicht ermutigend. Hier besteht dringend weiterer Forschungsbedarf.
Professor Stephan Mühlig
- Position: Leiter Psychosoziale Beratungsstelle und Raucherambulanz, TU Chemnitz; Koautor der S3-Leitlinie Tabakkonsum.
- Werdegang: Studium der Psychologie und Sozialwissenschaften an der Uni Oldenburg. Ab 1990 Uni Oldenburg; Promotion; Uni Bremen. Ab 2003 Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden, Leiter der AG Suchtforschung; 2004-2006 Vertretungsprofessur Humboldt Univ. Berlin; 2006/07 leitender Psychologe am Humboldt-Klinikum Berlin (Vivantes); seit 2007 ordentlicher Professor für Klinische Psychologie an der TU Chemnitz.
- Engagement: 2011 Gründung des Kooperationsnetzes Universitärer Raucherambulanzen (KURA e.V.); Wissenschaftlicher Arbeitskreis Tabakentwöhnung. 2018 Gründung der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz TU Chemnitz (PHA-TUC); Chefredaktion Zeitschrift SUCHT; 2020/21 Kongresspräsident Deutscher Suchtkongress.
Die Tabak-Leitlinie aus 2015 wird derzeit überarbeitet. Welche Erkenntnisse aus den vergangenen fünf Jahren dürften Ihrer Meinung nach einfließen?
Mühlig: Es sind große multizentrische Studien erschienen, die die Effektivität von Vareniclin mit hohen Effektstärken gesichert haben. Frühere Sicherheitsbedenken bei multimorbiden und kardiovaskulär erkrankten Menschen haben sich nicht bestätigt.
Das zweite große Thema sind die E-Zigaretten. Studien bestätigen zwar, dass schwer chronifizierte Raucher die E-Zigarette erfolgreich zur Tabakentwöhnung nutzen können. Andererseits ist das Inhalieren der verdampften Liquids mit Gefahren verbunden.
Die Bemühungen, die Inhaltsstoffe auf EU-Ebene nach Arzneimittelrecht zu definieren, sind gescheitert. Das heißt, im Einzelfall wissen wir nicht, was in diesen Geräten enthalten ist und ob die Deklaration der Inhaltsstoffe vertrauenswürdig ist. Daher raten wir in der klinischen Praxis im Regelfall von der E-Zigarette ab. Allerdings gibt es meiner Meinung nach durchaus in Einzelfällen andere Risiko-Nutzen-Abwägungen, wo die E-Zigarette zur Schadensminimierung und als ultima ratio in Frage kommen kann. Weiterhin gab es Studien zur Hypnose, doch die Daten bleiben widersprüchlich und die Effektstärken sind meist nicht überzeugend.
Ein neuer Trend sind Nichtraucher-Apps...
Mühlig: Online-Therapien unter anderem mithilfe von Nichtraucher-Apps halte ich für vielversprechend, auch wenn man berücksichtigen muss, dass an den Studien bevorzugt technikaffine Menschen teilgenommen haben. Mit solchen Apps wird versucht, ein verhaltenstherapeutisches Programm in das digitale Format zu überführen. Dazu gehören diagnostische Werkzeuge, Motivationshilfen, Verhaltensanalysen, unter Umständen aber auch ein bilateraler Informationsaustausch. Wir entwickeln derzeit ebenfalls gemeinsam mit einem Industriepartner eine entsprechende Gesundheits-App, die vom BMG zertifiziert werden soll.
Gibt es vermeidbare Fehler, die im Umgang mit entwöhnungswilligen Rauchern gemacht werden?
Mühlig: Ich habe bereits mehrfach gehört, dass Ärzte schwangeren Frauen empfohlen haben sollen, ruhig weiter zu rauchen, um keine Fehlgeburt zu riskieren. Das halte ich für unverantwortlich. Wenn sich jemand in einer Lebenssituation befindet, die zu einem Rauchstopp motivieren kann, sollte diese genutzt werden, etwa die Diagnose einer COPD oder die eingetretene Schwangerschaft.
Es ist die Möglichkeit, die kognitive Dissonanz beim Raucher zu nutzen: Der Widerspruch zwischen dem, was ich tue, also Rauchen, und dem von dem ich weiß, was dabei herauskommt, nämlich Krankheit oder Gesundheitsgefährdung von Kindern. Wird dieser Widerspruch aktuell und emotional erfahren, erreicht das eher auch Handlungswirksamkeit.
Die folgende Bereitschaft, mit dem Rauchen aufzuhören, sollte gleich verbindlich vereinbart und abgesichert werden. Ich sollte den Flyer mit der Telefonnummer einer Entwöhnungsambulanz sofort aus der Schublade ziehen können und „Nägel mit Köpfen machen“.
Das WHO-Motto zum Weltnichtrauchertag in diesem Jahr lautet „Schutz der Jugend vor Manipulation durch die Industrie“. Man wolle systematische und aggressive Strategien der Tabakindustrie offenlegen. Was denken Sie, ist damit gemeint?
Mühlig: Zunächst einmal ist positiv hervorzuheben, dass die Raucherquote in den jüngsten Altersgruppen der deutschen Bevölkerung in den letzten 15 Jahren massiv zurückgegangen ist. Offensichtlich war das Gesamtpaket von Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche in Deutschland wirklich erfolgreich. Aber es gibt immer noch ärgerliche Defizite, was die Werbung anlangt. Es wird vielfach behauptet, der Gesetzgeber und die Industrie seien sensibel geworden, würden auf die Jugend Rücksicht nehmen und sie in der Werbung nicht mehr zum Rauchen verführen.
Außenwerbung für Tabakprodukte in Deutschland wird – erst mit jahrelanger Verzögerung – zwar jetzt endlich verboten, aber es wird aktuell vor allem weiterhin indirekte Werbung gemacht. Ich habe beispielsweise den Eindruck, dass in Fernsehfilmen, vor allem Krimis, wieder mehr geraucht wird.
Insbesondere werden Peers oder jugendspezifische Settings und Auslösereize in Werbeanzeigen, Spots oder bei indirekter Werbung in den Vordergrund gestellt, über die indirekt eben doch die jugendliche Zielgruppe angesprochen wird. Jugendbezogene Werbung ist besonders inakzeptabel, denn der jugendliche Organismus ist im Wachstum extrem vulnerabel für Schädigungen durch Rauchen. Je früher man anfängt, diese Schadstoffe in Kombination mit Suchtstoffen zu konsumieren, desto höher das langfristige Schadenspotenzial und desto schwieriger wird die Entwöhnung.
Auf der anderen Seite ist es toll, was in den vergangenen Jahren für Fortschritte bei der Verhältnisprävention erzielt worden sind, zum Beispiel dass in Restaurants heute selbstverständlich nicht mehr geraucht wird und alle das befürworten, selbst die aktiven Raucher. Das wäre vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen.
Professor Mühlig, vielen Dank für das Gespräch!