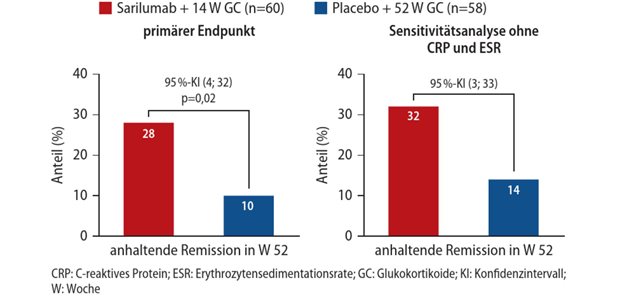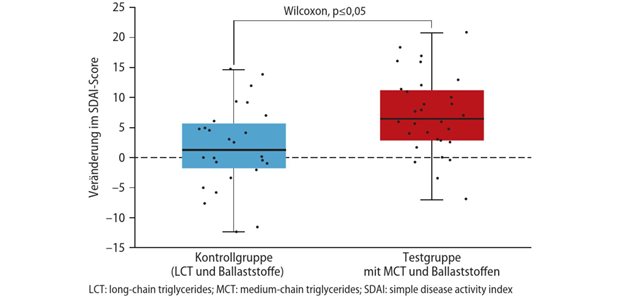Versorgungsforschung
Ein Wegweiser zu chronischen Krankheiten
Was heißt es, in Deutschland chronisch krank zu sein? Ein neues Kompendium bringt Licht ins Dunkel.
Veröffentlicht:Berlin. Obwohl chronische Krankheiten weit verbreitet sind, ist der Begriff „chronisch krank“ bislang nicht einheitlich definiert – weder national noch international. Darauf weist ein kürzlich erschienenes Kompendium des Instituts für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt im Auftrag der Robert Bosch Stiftung hin. Titel der Arbeit: „Chronisch krank sein in Deutschland: Zahlen, Fakten und Versorgungserfahrungen“.
Sowohl in der Wissenschaft wie auch der Statistik, heißt es darin, finde der Begriff keine einheitliche Anwendung, schreiben die Autorinnen Dr. Corina Güthlin, Dr. Susanne Köhler und Mirjam Dieckelmann.
Ziel des Reports sei es daher, einen „Pfad durch den Dschungel aus Datenquellen, Definitionen und verschiedenen Kennzahlen zu chronischen Krankheiten zu bahnen“. Verdichtet ergeben sich aus der Studie unter anderem folgende Schlussfolgerungen:
Etwa 43 Prozent der Frauen und 38 Prozent der Männer bezeichnen sich als chronisch krank. Die Häufigkeit steigt mit zunehmendem Alter: Bei den unter 30-Jährigen fühlt sich jeder Fünfte betroffen, bei den 65-Jährigen ist es jeder Zweite.
Die Häufigkeiten einzelner chronischer Krankheiten unterscheiden sich stark: Sie reichen von einzelnen wenig Tausend Fällen bei den seltenen Erkrankungen über acht Prozent der Erwachsenen bei Diabetes mellitus bis hin zum Spitzenreiter Hypertonie, an der knapp ein Drittel aller Erwachsenen erkrankt sind.
Chronische Krankheiten führen nicht selten zu stationärer Behandlung – bei Diabetes oft infolge von Komplikationen. Mit Abstand häufigster stationärer Behandlungsanlass ist Herzinsuffizienz. Dahinter folgen Suchterkrankungen, Schlaganfall und Rückenleiden.
Bei den weitverbreiteten chronischen Leiden zeichnen sich Arthritis, COPD und Herzinsuffizienz durch einen hohen, Bluthochdruck und Allergien durch einen eher geringen Verlust an gesundheitsbezogener Lebensqualität aus.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebsleiden verursachen die höchste und zusammen mit Muskel-Skelett-Erkrankungen etwa die Hälfte der gesamten Krankheitslast. Während bei der koronaren Herzkrankheit die vorzeitige und bei Rückenschmerzen gesundheitliche Einschränkungen dominieren, wird die Krankheitslast bei Diabetes Typ 2 von beiden Komponenten bestimmt.
Mithilfe von DMP und einer Stärkung der hausarztzentrierten Versorgung lässt sich die Behandlung von chronischen Krankheiten verbessern. Derzeit sind rund 7,1 Millionen Versicherte in einem oder in mehreren DMP eingeschrieben – am häufigsten in Programmen für Diabetes-Typ-2 mit etwa 4,3 Millionen Teilnehmern.
An Hausarztmodellen sind aktuell rund 5,4 Millionen Patienten und etwa 17 .000 Ärzte beteiligt. Effekte sind unter anderem weniger Einweisungen ins Krankenhaus und eine gezieltere Arzneimitteltherapie.